So nachhaltig sind Sie derzeit:
Auswertung der einzelnen Fragen
Existenz eines Abschussplans und einer Abschussliste
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Existenz eines Abschussplans und einer Abschussliste (als Teile eines Jagdkonzepts) dokumentiert, dass jagdliche Eingriffe in Wildbestände geplant und (zur Orientierung der zukünftigen Planung) auch dokumentiert werden. Da Abschusspläne normalerweise einer behördlichen Bewilligungspflicht unterliegen, ist davon auszugehen, dass auch behördlicherseits darauf geachtet wird, dass keine Wildart über- & unterbejagt wird und eine Abstimmung der Bejagung mit anderen Landnutzungsinteressen erfolgt. Bei der Erstellung der Abschusslisten ist vor allem in wildbiologischen Lebensraumgrößen zu denken (z.B. siehe WÖRP in der Begriffsdefinition) und Pläne sollten für großräumig agierende Wildarten mit betreffenden Reviernachbarn und Landnutzungsinteressenten im gemeinsamen Interesse aller abgestimmt sein (z.B. Hegeringe). Ein Jagdkonzept samt einer Abschussliste ist nicht nur bei Wildarten, wo Abschussplan und Abschussliste behördlich vorgeschrieben sind, vorteilhaft, sondern auch bei anderen – insbesondere bei gefährdeten und sensiblen – Wildarten (siehe Begriffsdefinitionen) sowie bei Wildarten mit „Reduktionsbedarf“ (siehe Kapitel 1.1.1.3). Wesentlich ist die artenspezifische Führung von Abschusslisten, d. h. ungenaue Sammelbezeichnungen (Zusammenfassung nach Artengruppen, wie z. B. Enten, Gänse, Hasen, Wiesel, Iltisse, etc.) sollten vermieden werden.
Gliederung von Abschussplan und Abschussliste
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Eine Gliederung der Abschusspläne nach Geschlecht und Alter(-sklasse) sowie der Abschusslisten nach Einzelarten, Datum, gleichfalls Geschlecht und Alter(-sklasse) (sofern praktikabel feststellbar, auch bei schwieriger zu bestimmenden Tierarten wie z.B. Feldhase, Fuchs...) sowie gegebenenfalls nach dem Erlegungsort (bzw. bei Bewegungsjagden nach dem Gebiet) ist für den Vergleich des angestrebten mit dem dann tatsächlich getätigten Abschuss sowie für dessen zeitliche und gegebenenfalls räumliche Zuordnung gerade im Hinblick auf andere Landnutzungen besonders wichtig.
Erfüllung behördlicher und anderer Abschussvorgaben bei Wildarten mit Reduktionsbedarf
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Abschussplanung ist potenziell eines der effektivsten Steuerungsinstru¬mente der Wildbewirtschaftung. Bei sachgerechter Handhabung bietet die Abschussplanerstellung die Möglichkeit, durch die Erhöhung oder Absenkung von Abschussziffern flexibel auf Wildstandsveränderungen sowie auf die Ergebnisse forstlicher Beobachtungssysteme (geben meistens keinen Rückschluss auf die Wildart, die den Verbiss verursacht hat, siehe Kapitel 1.1.2.2) zu reagieren. Vorausgesetzt ist, dass der Abschussplan auf die Höhe des realen Wildzuwachses ausgelegt wird. Abschusspläne stellen gleichsam das jagdliche Bindeglied dar, das die Koppelung zwischen dem Vegetationszustand, der Wildstandsregulierung und Naturschutzaspekten ermöglicht. Sie dienen gleichermaßen der Erhaltung von nachhaltig jagdlich nutzbaren Wildbeständen wie der Vermeidung von landeskulturell untragbaren Wildeinflüssen. Damit Abschusspläne in der Praxis auch tatsächlich eine Steuerungsfunktion in diesem Sinne ausüben können, ist die verbindliche Festsetzung realitätsbezogener, erfüllbarer Abschusspläne wesentlich. Die Vorgabe von Mindestabschüssen oder Maximalabschüssen je nach Wildart und Sozialklasse kommt dieser Praxisanforderung sehr entgegen. Neben den allgemeinen behördlich vorgegebenen Abschussplänen sind mit dem gegenständlichen Indikator auch zusätzliche behördliche Abschussvorgaben für nachweislich überhandnehmende, d. h. sowohl regional (Rote Listen) als auch überregional nicht gefährdete oder geschützte (z. B. Vogelschutz-Richtline der EU) Wildarten mit (lokal und zeitlich beschränktem) Reduktionsbedarf gemeint. Darüber hinaus bezieht sich der gegenständliche Indikator neben den behördlichen Abschussverpflichtungen auch auf mögliche, seitens des jagdberechtigten Grundeigentümers bestehende Abschussvorgaben für Wildarten mit Reduktionsbedarf, für die aber keine behördlichen Abschussvorgaben bestehen (z.B. Schwarzwild, unerwünschte nicht heimische Arten etc.). Wenn beispielsweise Jagdpächter oder langfristige Abschussnehmer durch den jagdberechtigten Waldeigentümer vertraglich (schriftlich oder mündlich) dazu angehalten sind, zum Zwecke der Wildstandsregulierung im landeskulturellen Interesse (wobei auch die Umgebung des betreffenden Jagdgebiets zu berücksichtigen ist) Mindestabschüsse zu tätigen bzw. Zielwerte für jährliche Abschüsse zu erfüllen, so ist dies ebenfalls zu bewerten. Eine Zielvorgabe könnte zum Beispiel auch sein, über die Mindestabschüsse hinaus alle gesehenen bzw. abschussmöglichen Tiere einer Art zu erlegen (z. B. Wildschweine, Rotfüchse).
Eine Region kann mit der Umsetzung einer Wildökologischen Raumplanung (siehe Begriffsdefinition WÖRP) in sogenannte Wildräume, Wildregionen und Wildbehandlungszonen unterteilt sein. Diese großräumigen Planungs- und Bewirtschaftungseinheiten entsprechen jeweils einem zusammenhängenden Lebensraum einer Wildart (z.B. Rot-, Gamswild etc.) für die Wildräume per Verordnung ausgewiesen werden. Kern-, Rand- und Freizonen werden innerhalb der Wildräume gesondert abgegrenzt. Im Gegensatz zu den langfristig gleichbleibend, populationsbezogenen Grenzen der Wildräume handelt es sich bei den Wildbehandlungszonen um großräumige mittelfristige Behandlungseinheiten innerhalb der Wildräume, die jeweils auf Grund der bestehenden Wald-Wild-Umweltsituation abgegrenzt werden müssen und bei schwerwiegenden Änderungen der Ausgangslage neuerlich anzupassen sind. In den Kern- und Randzonen erfolgt die Bewirtschaftung der Wildart im Rahmen von Abschussplänen. Die jagdbetrieblichen Maßnahmen sind darauf auszurichten, dass die betreffenden Wildarten in Kernzonen in gesunden Beständen erhalten bleiben, in Randzonen aber entweder nur vorübergehend oder nur in Beständen mit geringer Stückzahl vorhanden sind. Von den Freizonen soll die betreffende Wildart überhaupt ferngehalten werden.
Bewertet wird die Abweichung der im Abschussplan bzw. in anderweitigen – behördlichen und vertraglich geregelten – Abschussvorgaben für die betreffenden Wildarten vorgegebenen Soll-Werte bzw. Mindest- oder Maximalwerte von den tatsächlich getätigten Abschüssen. Wenn keine Mindest- oder Maximalabschüsse vorgegeben werden, kann eine geringfügige Abweichung toleriert werden. Anhand von neuesten Standards (z.B. online Jagdinformationssysteme zur Erfassung der Abschüsse) können zudem zeitnahe Abschussmeldungen das Vertrauen gegenüber Dritter steigern und Koordinationen (z.B. bei revierübergreifenden Abschussplänen) verbessern. Dieser Indikator bezieht sich auf Wildarten mit Reduktionsbedarf. Bezugszeitraum ist die jeweilige Planungsperiode der Abschussplanung.
Existenz einer Strategie zur Abstimmung der Bejagung mit anderen Landnutzungen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Anthropogene Einflussgrößen wie Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Straßenbau, Siedlungswesen, Naturschutz, etc. haben prägenden Einfluss auf die Wildlebensräume. Hier geht es nicht darum die Auswirkungen dieser anthropogenen Einflussgrößen selbst zu verifizieren, sondern darum, dass darauf geachtet wird, inwiefern die Jagdausübung in ihrer Strategie die anthropogenen Einflussgrößen im bejagten Wildlebensraum berücksichtigt. Dabei ist auch die Kommunikation und gegenseitige Absprache der Jäger mit Repräsentanten „anderer anthropogener Einflussgrößen“ zu bewerten. Dokumentiert wird die Abstimmung der Bejagung mit den anderen Landnutzungen durch die Existenz einer entsprechenden Strategie im Jagdkonzept. Die gesetzliche Ausweisung von Habitatschutzgebieten, Ruhezonen und Ähnlichem kann dabei von Vorteil sein.
Existenz von Kontrollzaunflächen zur Überwachung des Wildeinflusses auf die Vegetation
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Eine bewährte Möglichkeit zur objektiven Feststellung und zur Berücksichtigung des Wildeinflusses auf die Vegetation bei der Bejagung ist die Errichtung von Verbisskontrollzäunen (eingezäunten Verbisskontrollflächen). Diese bieten die Möglichkeit, eine kleine, gezäunte und daher völlig verbissfreie Vegetationsfläche mit der ungezäunten Vegetationsfläche außerhalb des Zauns zu vergleichen. Bei richtiger Standortwahl besteht so die Möglichkeit, den Einfluss des aktuellen Verbisses auf die Vegetationszusammensetzung (Verjüngung des Waldes, Dauervegetation im landwirtschaftlichen Bereich, wie z. B. Feldraine) festzustellen. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass die völlig ohne Wildeinfluss entstandene Vegetation innerhalb des Zauns nicht als natürlicher Zustand betrachtet wird, sondern lediglich als Vergleichsfläche zur Feststellung des Wildeinflusses dient. Ob dieser Einfluss die Vegetationsvielfalt erhöht oder vermindert oder keines von beidem bedeutet, kann objektiv überprüft werden.
Durch landesweite Walderhebungen und Biotopkartierungen im landwirtschaftlichen Bereich können für viele Gebiete gute Unterlagen über die aktuelle Vegetation und – zumindest für die Waldvegetation – auch für die potenzielle natürliche Vegetation existieren, wodurch auch ein Vergleich des Ist-Zustands mit einem Soll-Zustand möglich ist.
Das Vorhandensein bestimmter Weiserpflanzen in der Bodenvegetation kann den Biotopzustand gut charakterisieren. Ein Hinweis auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Wildstand (insbesondere Schalenwild und Hase) und Nahrungsangebot ist dabei das Vorhandensein seltener, gern verbissener Pflanzen, wohingegen deren Fehlen bei gleichzeitigem dominanten Auftreten bestimmter verbissharter (weil stacheliger / dorniger / bitterer / giftiger) Pflanzen überhöhte Wildstände charakterisiert. Eine Liste entsprechender Weiserpflanzen kann spezifisch für den jeweiligen Wildlebensraum erstellt werden. Ein laufendes Monitoring des Wildeinflusses auf die Waldvegetation bzw. auf Holzgewächse stellt sowohl für jagdausübende als auch für nicht jagende Waldeigentümer (in ihrer Rolle als Jagdverpächter) eine wesentliche Informationsgrundlage dar, die es ermöglicht, Bejagungsstrategie und Jagdkonzept am aktuellen Vegetationszustand auszurichten. Eine entsprechende Orientierung der Bejagungsstrategie an den potentiell natürlichen Waldgesellschaften (siehe Begriffsdefinition PNWG) sollte im Bejagungskonzept Eingang finden.
Berücksichtigung der Ergebnisse objektiver forstlicher Beobachtungssysteme zur Einschätzung des Wildeinflusses auf den Wald
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Objektive, für die Beurteilungseinheit geeignete forstliche Beobachtungssysteme wie Trakte (Kontrollstreifen), Stichproben, Kontrollzäune, Flächenbegutachtung, bestandsweise Feststellung (Vollerhebungen) sind – unabhängig davon, ob sie behördlicherseits oder seitens eines Forstbetriebes durchgeführt werden – eine wichtige Orientierungshilfe für den Jäger, um den Einfluss des Schalenwildes auf die Vegetation im Äserbereich festzustellen. Zu beachten ist, dass diese Systeme unter Umständen jedoch keinen Rückschluss auf die Wildart, die den Verbiss verursacht hat geben. Indirekt können durch diese Beobachtungssysteme auch die Einflüsse der Jagd auf das Schalenwild und die Vegetation verifiziert und wichtige Rückschlüsse zur Optimierung der Bejagung gezogen werden.
Bestehende forstliche Beobachtungssysteme sollten daher stets Eingang in die jagdliche Planung finden. Dieser Indikator ist auch anwendbar, wenn im unmittelbaren Bereich des eigenen Jagdgebiets keine derartigen Einrichtungen bestehen, weil die Ergebnisse von Beobachtungssystemen, die auf betrieblicher oder regionaler Ebene vorhanden sind, grundsätzlich ebenfalls Rückschlüsse auf die Wildeinflusssituation im eigenen Jagdgebiet erlauben.
Verhinderung landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse im Wald
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Landeskultur umfasst den Schutz der Natur bzw. unserer Kulturlandschaft im Allgemeinen und damit auch den Schutz heimischer Tierarten. Sie umfasst zudem die Gewährleistung der Ausübung der Jagd und Fischerei, der Land- und Forstwirtschaft, sowie die Gewährleistung der Nutzungsrechte auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Landeskulturell untragbare Wildeinflüsse liegen insbesondere dann vor, wenn die wichtigen Funktionen des Waldes, an denen öffentliches Interesse besteht (Schutz-, Wohlfahrts- bzw. Klima/Wasser/Luft-, Erholungs- und Nutzfunktion, Lebensraum für Tiere und Pflanzen), gefährdet sind.
Unter landeskulturell untragbaren Wildeinflüssen ist hier ein primär im ökologischen Sinne nicht tolerierbarer (schädigender) Einfluss des Wildes auf Flora und Fauna zu verstehen. Der Einfluss des Wildes auf die Waldvegetation umfasst die Nahrungsaufnahme (Äsen, Verbiss, Schäle) sowie Fegen und Schlagen. Der landeskulturelle Blickwinkel stellt die über betriebswirtschaftliche Aspekte hinausgehende Betrachtungsweise dar. Der Begriff „Landeskultur“ hat insbesondere die über die forstbetriebliche Holzproduktion hinausgehenden Funktionen des Waldes (Schutz, Wohlfahrt, Erholung, biologische Vielfalt) aus jeweils gesamtgesellschaftlicher Sicht zum Inhalt, aber auch die Lebensraumfunktion und den ökologischen Wert von anderen Vegetationsbeständen (wie z. B. Magerrasen, artenreiche Orchideenwiesen...). Diese Sicht wird grundsätzlich durch die zuständigen Behörden – auf der Basis gesetzlicher Regelungen – repräsentiert.
Durch das Fehlen einiger wesentlicher natürlicher Feinde unserer Pflanzen fressenden Wildtiere und durch anthropogene Einflüsse auf unsere Wildlebensräume (v. a. Landnutzungen) sind diese – großräumig betrachtet – zumeist nicht naturnah. Dadurch können lokale Dichten und Verteilungsmuster der Wildtiere entstehen, die zu über das tolerierbare Maß hinausgehenden Einflüssen des Wildes auf die Vegetation führen. Die Jagd hat durch die räumlichen und zeitlichen Muster ihrer Ausübung und durch ihre jeweilige Intensität Einfluss auf Ausmaß und Umfang landeskulturell relevanter Wildeinflüsse und kann solche auch eigenständig verursachen. Sinnvolle Maßnahmen können z.B. Schwerpunktbejagungen in verjüngungsbedürftigen Beständen sein (um diese Bereiche weitgehend wild- und verbissfrei zu halten) bei gleichzeitiger Jagddruck Entlastung in unbedenklichere Wald- oder Vegetations(frei)flächen. Die Maßnahmen sollten in enger Kooperation mit der Forstbehörde, dem Waldeigentümer und dem Freizeit- und Erholungsmanagement abgestimmt sein.
Die Höhe landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse ist vor allem durch objektiv feststellbare Wildschäden (Monitoringsysteme, gemeldete Wildschäden, etc.) sowie mittels Kontrollzäunen ermittelbar.
Im Rahmen einer Wildökologischen Raumplanung werden sogenannte großräumige Wildbehandlungszonen ausgewiesen, die auf Grund der bestehenden Wald-Wild-Umweltsituation abgegrenzt werden (siehe Begriffsdefinition „WÖRP“).
Verhinderung landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse im Objektschutzwald (Wald mit Leitfunktion „Objektschutzwald“)
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Ein Objektschutzwald ist Wald, der Menschen bzw. Siedlungen, Anlagen (bewohnte Gebäude), Infrastruktur (öffentliche Straßen und Wege) oder kultivierten Boden etc., insbesondere vor Elementargefahren oder schädigenden Umwelteinflüssen schützt (z. B. vor Steinschlag, Lawinen, Muren, Hochwässern, Erdrutschen etc.) und dessen Erhaltung eine besondere Behandlung erfordert.
Die Landeskultur umfasst den Schutz der Natur bzw. unserer Kulturlandschaft im Allgemeinen und damit auch den Schutz der heimischen Tierarten; sie umfasst zudem die Gewährleistung der Ausübung der Jagd und Fischerei, der Land-, Alm- und Forstwirtschaft, sowie die Gewährleistung der Nutzungsrechte auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Landeskulturell untragbare Wildeinflüsse liegen insbesondere dann vor, wenn die wichtigen Funktionen des Waldes, an denen öffentliches Interesse besteht (Schutz-, Wohlfahrts- bzw. Klima/Wasser/Luft, Erholungs- und Nutzfunktion, Lebensraum für Tiere und Pflanzen), gefährdet sind.
Unter landeskulturell untragbaren Wildeinflüssen ist hier ein primär im ökologischen Sinne nicht tolerierbarer (schädigender) Einfluss des Wildes auf Flora und Fauna zu verstehen. Der Einfluss des Wildes auf die Waldvegetation umfasst die Nahrungsaufnahme (Äsen, Verbiss, Schäle) sowie Fegen und Schlagen. Der landeskulturelle Blickwinkel stellt die über betriebswirtschaftliche Aspekte hinausgehende Betrachtungsweise dar. Der Begriff „Landeskultur“ hat insbesondere die über die forstbetriebliche Holzproduktion hinausgehenden Funktionen des Waldes (Schutz, Wohlfahrt, Erholung, biologische Vielfalt) aus jeweils gesamtgesellschaftlicher Sicht zum Inhalt, aber auch die Lebensraumfunktion und den ökologischen Wert von anderen Vegetationsbeständen (wie z. B. Magerrasen, artenreiche Orchideenwiesen...). Diese Sicht wird grundsätzlich durch die zuständigen Behörden – auf der Basis gesetzlicher Regelungen – repräsentiert.
Durch das Fehlen einiger wesentlicher natürlicher Feinde unserer Pflanzen fressenden Wildtiere und durch anthropogene Einflüsse auf unsere Wildlebensräume (v. a. Landnutzungen) sind diese – großräumig betrachtet – zumeist nicht naturnah. Dadurch können lokale Dichten und Verteilungsmuster der Wildtiere entstehen, die zu über das tolerierbare Maß hinausgehenden Einflüssen des Wildes auf die Vegetation führen. Die Jagd hat durch die räumlichen und zeitlichen Muster ihrer Ausübung und durch ihre jeweilige Intensität Einfluss auf Ausmaß und Umfang landeskulturell relevanter Wildeinflüsse und kann solche auch eigenständig verursachen. Sinnvolle Maßnahmen können z.B. Schwerpunktbejagungen in Schutzwaldbereichen oder verjüngungsbedürftigen Beständen sein (um diese Bereiche weitgehend wild- und verbissfrei zu halten) bei gleichzeitiger Jagddruck Entlastung in unbedenklichere Wald- oder Vegetations(frei)flächen. Die Maßnahmen sollten in enger Kooperation mit der Forstbehörde, dem Waldeigentümer und dem Freizeit- und Erholungsmanagement abgestimmt sein.
Die Höhe landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse ist vor allem durch objektiv feststellbare Wildschäden (Monitoringsysteme, gemeldete Wildschäden, etc.) sowie mittels Kontrollzäunen ermittelbar.
Im Rahmen einer Wildökologischen Raumplanung werden sogenannte großräumige Wildbehandlungszonen ausgewiesen, die auf Grund der bestehenden Wald-Wild-Umweltsituation abgegrenzt werden (siehe Begriffsdefinition „WÖRP“).
Verhinderung landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse im sonstigen (Standort-)Schutzwald (Wald mit Leitfunktion „Sonstiger Schutzwald“)
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Ein sonstiger (Standort-)Schutzwald ist Wald, welcher vor allem seinen Standort vor abtragenden Kräften der Umwelteinflüsse wie Wind, Wasser oder Schwerkraft schützt. Diese Wälder bedürfen einer besonderen Behandlung zum Schutz des Bodens und des Bewuchses sowie zur Sicherung der Wiederbewaldung.
Die Landeskultur umfasst den Schutz der Natur bzw. unserer Kulturlandschaft im Allgemeinen und damit auch den Schutz der heimischen Tierarten; sie umfasst zudem die Gewährleistung der Ausübung der Jagd und Fischerei, der Land- und Forstwirtschaft, sowie die Gewährleistung der Nutzungsrechte auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Landeskulturell untragbare Wildeinflüsse liegen insbesondere dann vor, wenn die wichtigen Funktionen des Waldes, an denen öffentliches Interesse besteht (Schutz-, Wohlfahrts bzw. Klima/Wasser/Luft-, Erholungs- und Nutzfunktion, Lebensraum für Tiere und Pflanzen), gefährdet sind.
Unter landeskulturell untragbaren Wildeinflüssen ist hier ein primär im ökologischen Sinne nicht tolerierbarer (schädigender) Einfluss des Wildes auf Flora und Fauna zu verstehen. Der Einfluss des Wildes auf die Waldvegetation umfasst die Nahrungsaufnahme (Äsen, Verbiss, Schäle) sowie Fegen und Schlagen. Der landeskulturelle Blickwinkel stellt die über betriebswirtschaftliche Aspekte hinausgehende Betrachtungsweise dar. Der Begriff „Landeskultur“ hat insbesondere die über die forstbetriebliche Holzproduktion hinausgehenden Funktionen des Waldes (Schutz, Wohlfahrt, Erholung, biologische Vielfalt) aus jeweils gesamtgesellschaftlicher Sicht zum Inhalt, aber auch die Lebensraumfunktion und den ökologischen Wert von anderen Vegetationsbeständen (wie z. B. Magerrasen, artenreiche Orchideenwiesen...). Diese Sicht wird grundsätzlich durch die zuständigen Behörden – auf der Basis gesetzlicher Regelungen – repräsentiert.
Durch das Fehlen einiger wesentlicher natürlicher Feinde unserer Pflanzen fressenden Wildtiere und durch anthropogene Einflüsse auf unsere Wildlebensräume (v. a. Landnutzungen) sind diese – großräumig betrachtet – zumeist nicht naturnah. Dadurch können lokale Dichten und Verteilungsmuster der Wildtiere entstehen, die zu über das tolerierbare Maß hinausgehenden Einflüssen des Wildes auf die Vegetation führen. Die Jagd hat durch die räumlichen und zeitlichen Muster ihrer Ausübung und durch ihre jeweilige Intensität Einfluss auf Ausmaß und Umfang landeskulturell relevanter Wildeinflüsse und kann solche auch eigenständig verursachen. Sinnvolle Maßnahmen können z.B. Schwerpunktbejagungen in Schutzwaldbereichen oder verjüngungsbedürftigen Beständen sein (um diese Bereiche weitgehend wild- und verbissfrei zu halten) bei gleichzeitiger Jagddruck Entlastung in unbedenklichere Wald- oder Vegetations(frei)flächen. Die Maßnahmen sollten in enger Kooperation mit der Forstbehörde, dem Waldeigentümer und dem Freizeit- und Erholungsmanagement abgestimmt sein.
Die Höhe landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse ist vor allem durch objektiv feststellbare Wildschäden (Monitoringsysteme, gemeldete Wildschäden, etc.) sowie mittels Kontrollzäunen ermittelbar.
Im Rahmen einer Wildökologischen Raumplanung werden sogenannte großräumige Wildbehandlungszonen ausgewiesen, die auf Grund der bestehenden Wald-Wild-Umweltsituation abgegrenzt werden (siehe Begriffsdefinition „WÖRP“).
Verhinderung landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse im Wirtschaftswald (Wald ohne Leitfunktion „Schutzwald“)
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Unter Wirtschaftswald verstehen sich alle Wälder, welche nicht als Schutzwald ausgewiesen sind.
Die Landeskultur umfasst den Schutz der Natur bzw. unserer Kulturlandschaft im Allgemeinen und damit auch den Schutz der heimischen Tierarten; sie umfasst zudem die Gewährleistung der Ausübung der Jagd und Fischerei, der Land- und Forstwirtschaft, sowie die Gewährleistung der Nutzungsrechte auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Landeskulturell untragbare Wildeinflüsse liegen insbesondere dann vor, wenn die wichtigen Funktionen des Waldes, an denen öffentliches Interesse besteht (Schutz-, Wohlfahrts bzw. Klima/Wasser/Luft-, Erholungs- und Nutzfunktion, Lebensraum für Tiere und Pflanzen), gefährdet sind.
Unter landeskulturell untragbaren Wildeinflüssen ist hier ein primär im ökologischen Sinne nicht tolerierbarer (schädigender) Einfluss des Wildes auf Flora und Fauna zu verstehen. Der Einfluss des Wildes auf die Waldvegetation umfasst die Nahrungsaufnahme (Äsen, Verbiss, Schäle) sowie Fegen und Schlagen. Der landeskulturelle Blickwinkel stellt die über betriebswirtschaftliche Aspekte hinausgehende Betrachtungsweise dar. Der Begriff „Landeskultur“ hat insbesondere die über die forstbetriebliche Holzproduktion hinausgehenden Funktionen des Waldes (Schutz, Wohlfahrt, Erholung, biologische Vielfalt) aus jeweils gesamtgesellschaftlicher Sicht zum Inhalt, aber auch die Lebensraumfunktion und den ökologischen Wert von anderen Vegetationsbeständen (wie z. B. Magerrasen, artenreiche Orchideenwiesen...). Diese Sicht wird grundsätzlich durch die zuständigen Behörden – auf der Basis gesetzlicher Regelungen – repräsentiert.
Durch das Fehlen einiger wesentlicher natürlicher Feinde unserer Pflanzen fressenden Wildtiere und durch anthropogene Einflüsse auf unsere Wildlebensräume (v. a. Landnutzungen) sind diese – großräumig betrachtet – zumeist nicht naturnah. Dadurch können lokale Dichten und Verteilungsmuster der Wildtiere entstehen, die zu über das tolerierbare Maß hinausgehenden Einflüssen des Wildes auf die Vegetation führen. Die Jagd hat durch die räumlichen und zeitlichen Muster ihrer Ausübung und durch ihre jeweilige Intensität Einfluss auf Ausmaß und Umfang landeskulturell relevanter Wildeinflüsse und kann solche auch eigenständig verursachen. Sinnvolle Maßnahmen können z.B. Schwerpunktbejagungen in gefährdeten Waldbereichen oder verjüngungsbedürftigen Beständen sein (um diese Bereiche weitgehend wild- und verbissfrei zu halten) bei gleichzeitiger Jagddruck Entlastung in unbedenklichere Wald- oder Vegetations(frei)flächen. Die Maßnahmen sollten in enger Kooperation mit der Forstbehörde, dem Waldeigentümer und dem Freizeit- und Erholungsmanagement abgestimmt sein.
Die Höhe landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse ist vor allem durch objektiv feststellbare Wildschäden (Monitoringsysteme, gemeldete Wildschäden, etc.) sowie mittels Kontrollzäunen ermittelbar.
Im Rahmen einer Wildökologischen Raumplanung werden sogenannte großräumige Wildbehandlungszonen ausgewiesen, die auf Grund der bestehenden Wald-Wild-Umweltsituation abgegrenzt werden (siehe Begriffsdefinition „WÖRP“).
Verhinderung landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse im Grünland
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Die Landeskultur umfasst den Schutz der Natur bzw. unserer Kulturlandschaft im Allgemeinen und damit auch den Schutz der heimischen Pflanzen- und Tierarten. Sie umfasst zudem die Gewährleistung der Ausübung der Land- und Forstwirtschaft, der Jagd und Fischerei sowie die Gewährleistung der Nutzungsrechte auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Begriff „Landeskultur“ hat insbesondere die über die Produktion von Biomasse (Nahrungsmittel, Futtermittel, biogene Rohstoffe und Energieträger) hinausgehenden Funktionen von landwirtschaftlichen Offenlandflächen (biologische Vielfalt, Landschaftsbild, Kulturlandschaftscharakter, etc.) aus gesamtgesellschaftlicher Sicht zum Inhalt, insbesondere die Lebensraumfunktion und den ökologischen Wert von Vegetationsbeständen (wie z. B. artenreicher Orchideenwiesen, Magerrasen..). Landeskulturell untragbare Wildeinflüsse liegen insbesondere dann vor, wenn diese Funktionen von Grünlandflächen beeinträchtigt sind. Diese Sicht wird grundsätzlich durch die zuständigen Behörden – auf der Basis gesetzlicher Regelungen – repräsentiert.
Unter landeskulturell untragbaren Wildeinflüssen ist hier ein primär im ökologischen Sinne nicht tolerierbarer (schädigender) Einfluss des Wildes auf die Vegetation landwirtschaftlicher Flächen zu verstehen. Dies betrifft z.B. insbesondere Wildschäden an ökologisch wertvollen Grünlandbeständen, wie sie durch den Umbruch von Wiesen, Rasen und Weiden durch Schwarzwild entstehen können. Darüber hinaus kann starker Äsungsdruck durch überhöhte Populationen wiederkäuender Schalenwildarten (Rotwild, Rehwild, Damwild, Muffelwild) zu Vegetationsveränderungen und zur Degradierung mancher sensibler Grünlandbiotope führen. Der landeskulturelle Blickwinkel stellt die über betriebswirtschaftliche Aspekte hinausgehende Betrachtungsweise dar. Wildschäden an Ackerkulturen (Marktfrüchten) sind zwar betriebswirtschaftlich relevant, gelten hier aber nicht als landeskulturell untragbar.
Als ökologisch wertvoll bzw. anderweitig – z. B. im Hinblick auf die Erhaltung des regionaltypischen Landschaftsbildes– landeskulturell relevant sind insbesondere Wiesen, Rasen und Weiden zu betrachten, die naturschutzrechtlich geschützte oder naturschutzfachlich anderweitig seltene, gefährdete und besonders wertvolle Vegetationsbestände, faunistische Artenausstattungen oder Einzelarten aufweisen, oder die besonders prägend für den ortstypischen Landschaftscharakter sind. Hierzu zählen insbesondere Grünlandbestände, die zu den Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zählen, die Unterschutzstellungsgründe für Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und flächige Naturdenkmäler nach Landes-Naturschutzrecht darstellen und die Gegenstand von Naturschutzmaßnahmen und -projekten im Rahmen des Vertragsnaturschutzes sind. Im Gegensatz zu Fraßschäden an einjährigen Feldkulturen kann der Umbruch von Grünland durch Schwarzwild langfristige Schäden an Vegetationsbeständen verursachen, die oft nur schwer oder überhaupt nicht wiederherstellbar sind und zu Folgeproblemen führen können (z.B. auf Almflächen Murenabgänge). Einen Sonderfall negativer Wildeinflüsse auf landwirtschaftlichen Standorten stellt die Zerstörung der Gelege bzw. der Fraß von Jungtieren bodenbrütender Vogelarten dar. Wenn es sich bei den betroffenen Vogelarten um geschützte, gefährdete oder seltene Arten handelt ist dies ebenfalls als landeskulturell untragbarer Wildeinfluss zu werten.
Grundsätzlich sind stark zunehmende landeskulturell untragbare Schäden z. B. durch Schwarzwild an landwirtschaftlichen Flächen als eine direkte Folge der in den letzten Jahrzehnten stark angewachsenen Schwarzwildpopulationen zu betrachten. Für die Regulation des Schwarzwildbestands durch effiziente Bejagung ist in erster Linie die Jagd zuständig, aber auch die Art der Waldbewirtschaftung und die Landwirtschaft hat Einfluss auf die Verteilung des Schwarzwildes und dessen Verhalten. In beiden Fällen kann jedoch die Kooperation von der Jägerschaft mit den Landwirten und Forstwirten bei der Wildschadensvermeidung wesentliche Unterstützung leisten.
Von wesentlicher Bedeutung ist, dass Jagdverantwortliche die örtlichen Landwirte über festgestellte Wildschäden informieren und einen Konsens über die bestgeeignete gemeinsame Vorgangsweise anstreben. Erst dies ermöglicht optimale abgestimmte wirksame Maßnahmen auf jagdlicher Seite. Beispiele Schutzmaßnahmen:
• Schwerpunktbejagung
• Vermeiden von Lockwirkungen (keine Kirrungen, Salzlecken oder Fütterungen in nächster Nähe zu sensiblen Grünlandflächen)
• Kommunikation und Maßnahmenabstimmung mit der Forstwirtschaft und Landwirtschaft z.B. durch gezielte Lebensraumgestaltung, Äsungsverbesserung, Wildruhezonen, Anlage von Schussschneisen und -flächen zur Verbesserung der Bejagbarkeit, zeitlich abgestimmte Bejagungen zur Verminderung von Wildschäden im Offenland. Die diesbezügliche Kommunikation von Jägern mit der Forst- und Landwirtschaft sowie das Einfordern und die enge Abstimmung von Maßnahmen auf Forst- und Landwirtschaftsseite bilden auch hierbei eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Umsetzungen.
Die Höhe landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse ist durch objektiv feststellbare Wildschäden (Monitoringsysteme, gemeldete Wildschäden, etc.) ermittelbar.
Berücksichtigung von Bestandsschwankungen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Wildbestände weisen unter natürlichen, vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Bedingungen mehr oder weniger starke Bestandsschwankungen auf, die auf klimatische Einflüsse (Winterverluste), das Nahrungsangebot und die Präsenz von Feinden zurückzuführen sind. Unnatürlich sind hingegen konstante Bestandesdichten (solche können auch durch Fütterungen künstlich hoch gehalten werden). Bestandsschwankungen, die auf anthropogen bedingte Lebensraumdefizite zurückzuführen sind, sind damit nicht gemeint. Bestandsschwankungen sind bei jagdbaren Wildarten anhand der jährlichen Strecken sowie z. T. anhand der Verbissbelastung der Vegetation nachvollziehbar. Aufgrund ihres prägenden Einflusses auf die Bodenvegetation ist es zumindest bei häufig vorkommendem Schalenwild sinnvoll, die jagdliche Akzeptanz der Bestandsschwankungen als Indiz für eine nachhaltige Jagd heranzuziehen.
Eine natürlich bedingte Bestandsabnahme der Schalenwildbestände (z. B. durch Witterungseinflüsse) ist gleichbedeutend mit einer Verbissentlastung der bevorzugten Äsungspflanzen. Unter naturnahen Verhältnissen (Vollständigkeit des Wildarteninventars auch bei den Großraubtieren) wird der reduzierte Wildbestand unmittelbar nach dem Bestandsrückgang nicht von seinen natürlichen Feinden „verschont“, wie dies häufig bei der traditionellen Jagd geschieht, sondern weiter reduziert oder tief gehalten, bis sich der reduzierte Bestand an Beutetieren auch auf Vermehrungsrate und Anwesenheit der natürlichen Feinde ausgewirkt hat. Die Zeitspanne, in der die Vegetation von ökologischen Wildschäden entlastet wird, ist daher unter naturnahen Bedingungen meist wesentlich länger, als wenn der Mensch durch Reduktion des Abschusses rasch auf eine Bestandsabnahme reagiert.
Eine längere Regenerationsmöglichkeit (Verbisspause) für die Vegetation bedeutet z. B. mehr Bäume und Sträucher, deren Haupttriebe dem Äserbereich entwachsen können, und damit auch ein Mehr an Äsung, Deckung und Witterungsschutz für die sich wieder aufbauende Wildpopulation. Die besseren natürlichen Äsungsbedingungen können in weiterer Folge einen höheren Abschuss als zuvor ermöglichen.
Eine rasche und zu starke Reduktion des Abschusses unmittelbar nach einer vorübergehenden, natürlich bedingten Bestandsabnahme häufig vorkommender Wildarten bringt hingegen ökologische Nachteile für das Ökosystem (inkl. dem bejagten Wild) mit sich. Ein weitgehender jagdlicher Ausgleich von Bestandsschwankungen, insbesondere des Schalenwildes, entspricht daher nicht der ökologischen Nachhaltigkeit.
Berücksichtigung bestehender Fragmentierung des Wildlebensraumes
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Fragmentierung (Zerschneidung) von Wildlebensräumen durch Straßen, Bahnlinien, Siedlungs- und Gewerbezonen sowie touristische Einrichtungen hat einen zentralen Einfluss auf die Lebensraumqualität. Bei starken Fragmentierungen kann es zu Verinselungen und in Folge zu genetischen Verarmungen der Wildtiere kommen. Eine Fragmentierung kann zwar nur bedingt jagdlich entschärft werden, indem wichtige Korridore, Migrationsachsen und Zwangswechsel zwischen Lebensräumen und Teilen derselben geringstmöglichem Jagddruck ausgesetzt oder attraktiver gestaltet werden; wird dies jedoch konsequent praktiziert, so ist dies ein wichtiger Beitrag für die nachhaltige Nutzbarkeit der Wildlebensräume. Bestehende Fragmentierungen von Wildlebensräumen können durch jagdliche Maßnahmen unter Umständen aber auch verschärft werden, z. B. durch erhöhten Jagddruck in sensiblen Bereichen, durch die Errichtung von Zäunen, um die Abwanderung von Wild zum Nachbarrevier zu verhindern, oder durch großflächige Wildgatter an ungünstigen Standorten. Da die Zerschneidung von Lebensräumen aufgrund der weiträumigen Lebensweise vieler Wildarten meist Auswirkungen hat, die über die örtliche Ebene hinausgehen, kann die Anwendung dieses Indikators auch in Jagdgebieten sinnvoll sein, auf deren Gebiet sich keine fragmentierende Infrastruktur befindet.
Feststellung und planliche Erfassung wichtiger Migrations¬achsen, Wildkorridore und Zwangswechsel
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Das Wissen um Lage, Verlauf und Nutzung wichtiger regionaler, überregionaler oder länderübergreifender Bewegungsachsen des Wildes (einschließlich solcher von Großraubwild wie Bär, Luchs oder Wolf) bildet die Voraussetzung dafür, dass Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Lebensraumvernetzung gesetzt und Wanderachsen in raumrelevante Planungen einbezogen werden können. Vor allem bei Verkehrsplanungen, insbesondere bei großräumigen oder hochrangigen, ist es wesentlich, die Mobilitätsbedürfnisse von Wildtieren möglichst frühzeitig zu berücksichtigen, um diese bereits in die Trassierungsplanung einbeziehen und den Bedarf an Grünbrücken und Wilddurchlässen rechtzeitig abschätzen zu können. Über die Wirksamkeit und die Annahme solcher technischer Wildpassagen durch das Wild entscheiden vor allem die richtige Standortwahl und die richtige Dimensionierung. Verlässliche Informationen über den Verlauf bedeutender Fernwechsel und historischer Wechsel sowie über deren Nutzung durch einzelne Wildarten bilden dabei eine unverzichtbare Planungsgrundlage. Ebenso ist qualifiziertes Wissen über Migrationsachsen, Korridore und Zwangswechsel die Voraussetzung dafür, dass diese in Raumplänen ausgewiesen, rechtsverbindlich abgesichert und von Bebauungen freigehalten werden können.
Als Revierkenner sind Jäger Experten vor Ort, die durch ihr örtliches Wissen und ihre Erfahrung wertvolle Beiträge zur Identifikation von Migrationsachsen, Korridoren und Zwangswechseln leisten können. Auch wenn festgestellt wird, dass keine Korridore und/oder Zwangswechsel im Jagdgebiet existieren, ist dies eine wesentliche Erkenntnis. Eine Zusammenarbeit mit Wildbiologen sollte dabei angestrebt werden. Vorhandene Fern-, Haupt- und Zwangswechsel sollten als Teil des Jagdkonzepts planlich dargestellt und Planern sowie anderen Landnutzern bei Bedarf mitgeteilt werden. Zur Beurteilung dieses Indikators ist eine diesbezügliche Kommunikation mit Jagdnachbarn unerlässlich.
Erhöhung der Attraktivität wichtiger Migrationsachsen, Wildkorridore und Zwangswechsel
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Möglichkeiten einer attraktiveren Gestaltung wichtiger Migrationsachsen, Korridore und Zwangswechsel (in Absprache mit den Grundbesitzern) sind vielfältig:
• Im offenen Gelände können Bewegungsachsen, Korridore und Zwangswechsel durch Anlage von Deckung und Äsung bietenden Leitlinien (Hecken, Ufergehölze, Windschutzgürtel, bepflanzte Raine, Brachflächen) attraktiver gestaltet und auch tagsüber nutzbar gemacht werden. Bei Überquerung weiter offener Strecken, kann ihre Attraktivität durch Anlage von Feldgehölzen (Zwischeneinstände) erhöht werden.
• Auch die Nutzbarkeit und Akzeptanz von Wilddurchlässen und Grünbrücken kann durch solche biotophegerischen Maßnahmen erhöht werden. Unbedingt erforderlich ist die Jagdfreistellung im Umkreis von mindestens rd. 200 m von technischen Wildpassagen.
• Zusätzlich kann die Attraktivität durch Anlage von Wildackerstreifen, Tränken (Suhlen) und Salzlecken erhöht werden.
• Reviergestaltung sollte sinnvollerweise auch durch die Nutzung von nationalen oder EU Agrarumweltprogrammen durch die Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen geschehen.
Aktive Erhaltung und Gestaltung des Wildlebensraumes
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Eignung unserer Wildlebensräume für heimische Wildarten ist – überwiegend anthropogen bedingt – teilweise eingeschränkt. Neben zunehmender Lebensraumeinengung durch die Ausdehnung von Siedlungsgebieten und Verkehrsflächen können z. B. auch stark beunruhigte Bereiche durch störungsempfindliche Arten nicht mehr – oder nur mehr eingeschränkt – genutzt werden. Viele derartige Einschränkungen der Lebensraumquantität und -qualität können durch Biotoppflege- und Gestaltungsmaßnahmen gemindert oder sogar völlig aufgehoben werden. Sowohl Agrarumweltprogramme (z. B. Förderprogramme der EU) als auch Förderungsaktionen der Landesjagd- und Naturschutzverbände bieten dem Jäger vielfältige Möglichkeiten, umfassende Biotopverbesserungen, v. a. für gefährdete und sensible Arten (siehe Begriffsdefinitionen), durchzuführen. Maßnahmen zur Landschaftspflege und Kulturlandschaftserhaltung in den Pflegezonen können durch Abstimmung auf die Lebensraumbedürfnisse des Wildes wesentlich zur Verbesserung der Habitatqualität beitragen. Hierbei ist vor allem auf eine ausgewogene räumliche und saisonale Verteilung von Strukturen und eingesetzter Maßnahmen zu achten. Biotopverbesserungsmaßnahmen bedürfen zwar i. d. R. des Einverständnisses des Grundeigentümers, erfordern aber zumeist das Engagement und das aktive Handeln der Jagdausübenden selbst.
Wesentlich für die Bewertung ist, dass Verbesserungsmaßnahmen nicht einseitig ökonomisch bedeutenden oder anderweitig jagdlich attraktiven Wildarten zugutekommen (z. B. Wild-Suhlen). Diese Maßnahmen sollen insbesondere auf die Abdeckung der Lebensraumerfordernisse von gefährdeten, sensiblen oder jagdlich wenig genutzten autochthonen Wildarten ausgerichtet sein. Gestaltungsmaßnahmen für ökonomisch bedeutende Arten dürfen sich auf gefährdete Arten nicht negativ auswirken, wie dies z. B. durch Kirrung der Fall sein kann. Regionale Listen der aktuell vorkommenden Wildarten, des potenziellen natürlichen Wildarteninventars sowie gefährdeter Wildarten (z. B. auf Basis von relevanten Roten Listen) und geschützter Arten (nach Naturschutzgesetzen, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, etc.) können hierbei eine wertvolle Hilfestellung geben. Von Maßnahmen zur Verbesserung und Erhaltung der Wildlebensräume, die heimischen Wildarten zugutekommen, profitieren i. d. R. auch andere, nicht jagdbare Tierarten.
Limitierung der Kirrung
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Unter „Kirrung“ versteht man die Vorlage geringer Mengen von attraktiven Kirrmittel an bestimmten Orten zur leichteren Abschusserfüllung („Ankirren“ des Wildes). Als vorteilhaft ist bei Kirrungen ein sichereres Ansprechen und vereinfachte (tierleidmindernde) Schussabgabe zu nennen. Die Menge der Kirrmittel muss aber limitiert (gesetzliche Bestimmungen einhalten) sowie nach Ort und Zeitraum der Vorlage eingeschränkt sein. Limitierungen und Einschränkungen müssen so erfolgen, dass die Kirrung keinen wesentlichen Beitrag zur Ernährung (Fütterung) des Wildes darstellt. Die Art der Vorlage ist so einzuschränken, dass eine Erreichbarkeit der Kirrmittel nur der Zielart (z.B. Schwarzwild) möglich ist.
Berücksichtigung von verschärftem Konkurrenzdruck auf gefährdete und sensible Tierarten durch stark zunehmende Wildpopulationen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Manche natürlichen Regulative für unsere Wildtiere, wie z. B. (manche) Großraubtiere, aber auch Krankheiten (z. B. Tollwut), existieren nicht mehr oder haben derzeit keinen bestandsregulierenden Einfluss auf unsere Wildbestände (z. B. infolge Ausrottung, Impfung). Ohne jagdliche Regulierung der Wildbestände würden daher in den meisten Revieren unserer Kulturlandschaft Überpopulationen entstehen, v. a. beim Schalenwild, aber auch beim Fuchs und beim Steinmarder. Diese würden dann ihrerseits einen unnatürlich hohen Druck auf ihre Beutetiere bzw. ihre Äsungspflanzen ausüben. Dies kann die Artenvielfalt, -häufigkeit und -verteilung sowohl der Flora als auch der Fauna durch Übernutzung nachhaltig verändern. Durch eine revierspezifische, an der Vegetationszusammensetzung und der Artenvielfalt der Wildtiere orientierte Bejagung, die auch die unterschiedlichen saisonalen Lebensraumkapazitäten berücksichtigt, können derartige negative Auswirkungen weitgehend vermieden werden. Eine solche Regulation von regional häufigen, nicht gefährdeten Wildarten ist insbesondere dann wesentlich, wenn durch deren starke Bestandszunahme die Erhaltung von Populationen gefährdeter und sensibler heimischer Tierarten bedroht ist. Die Berücksichtigung der Lebensraumkapazität in der jagdlichen Strategie („Jagdkonzept“) ist ein Indiz für eine nachhaltige Jagdausübung.
Höhe der jährlichen Zuwachsrate beim Schalenwild
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Dieser Indikator bezieht sich hier auf die Wiederkäuer. Der Begriff „Zuwachsrate“ bezeichnet die jährliche Zahl der Jungtiere pro weiblichen Tier. Die jährliche Zuwachsrate wird v. a. von der Lebensraumqualität und der Stärke der jagdlichen Eingriffe geprägt. Ob die Wilddichte dem Lebensraum angepasst ist oder nicht, ist z. B. beim Schalenwild anhand der Wildbretgewichte, der Verbissintensität und des Arteninventars der Vegetation feststellbar. Diese Faktoren haben sowohl direkten als auch indirekten Einfluss auf das Arteninventar der Wildtiere.
Die Wildbestandsdichte und das Abschöpfen der Zuwächse durch die Jagd haben einen – je nach Wildart unterschiedlichen – signifikanten Einfluss auf die Zuwachsrate der Population. Es kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass bei – gemessen an der Lebensraumkapazität – hohen Populationsdichten von jagdbaren Wiederkäuern, z. B. infolge zu geringer jagdlicher Entnahme, die durchschnittliche Zuwachsrate sinkt und bei intensiver Reduktion steigt. Die Höhe der jährlich nutzbaren Zuwächse kann daher – bei entsprechender Berücksichtigung der Erhaltung der Lebensraumqualität – eine gute Aussagekraft über die jagdliche Nutzung der Zuwächse haben. Bei überdurchschnittlichem Nahrungsangebot vor der Brunftzeit, wie beispielsweise durch intensive Fütterung, verliert jedoch die festgestellte jährliche Zuwachsrate an Aussagekraft über die tatsächliche jagdliche Nutzung der Zuwächse. Die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate kann durch Beobachtung meist hinreichend genau abgeschätzt werden.
Dazu ein Beispiel: In einem Rehwildrevier mit normaler ganzjähriger Äsungssituation, das kein überdurchschnittliches Nahrungsangebot vor der Brunft aufweist, tendiert ein in seiner Bestandsdichte an eine hohe Lebensraumqualität angepasster Rehbestand zu alljährlich 2 Kitzen/adulter Gais. Weist dasselbe Rehwildrevier jedoch einen – gemessen an der Biotopkapazität – stark überhöhten Rehbestand auf, so geht die Tendenz immer mehr zu 1 Kitz/adulter Gais, weiteres sind dann auch häufiger übergangene Schmalgaisen festzustellen.
Aktuelle und potenzielle natürliche Wildartenliste
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Aktuelle Wildartenliste: jene Wildarten, die aktuell vorkommen. Potenzielle natürliche Wildartenliste (siehe Begriffsdefinition): alle Wildarten, die vorkommen sollten. Das Vorhandensein einer aktuellen und einer potenziellen natürlichen Wildartenliste bei der jagdwirtschaftlich verantwortlichen Stelle ist ein Indiz dafür, dass die Vollständigkeit des potenziellen natürlichen Wildarteninventars eine Richtschnur der Bejagung ist und diese angestrebt bzw. erhalten wird.
Für den Vergleich des vorhandenen Wildarteninventars mit dem potenziellen natürlichen Wildarteninventar ist die Erstellung einer regionalen Liste des potenziellen natürlichen Wildarteninventars erforderlich. Unter Berücksichtigung der anthropogenen Einflüsse auf den Naturraum (durch Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Siedlungen, Verkehr Straße / Schiene, Tourismus, etc.) kann dazu die noch vorhandene Bewohnbarkeit der mittlerweile veränderten Kulturlandschaft für die ursprünglich vorhandenen einheimischen und gebietstypischen Wildarten abgewogen und so eine potenzielle natürliche Wildartenliste erstellt werden. Eine landeskulturell verbindliche wildökologische Raumplanung (WÖRP – siehe Begriffsdefinition) kann wesentliche Grundlagen für die Erstellung einer potenziellen natürlichen Wildartenliste liefern. Der Vergleich der aktuellen mit der potenziellen natürlichen Wildartenliste ermöglicht es, die Vollständigkeit bzw. Unvollständigkeit des jagdlich erzielbaren, potenziellen natürlichen Arteninventars (entsprechend den Möglichkeiten des gegebenen wirtschaftlichen und sozio-kulturellen Umfeldes) festzustellen und – unter anderem – den jagdlichen Einfluss auf die Artenausstattung zu bewerten.
Bei der Erstellung der Wildartenlisten kann es auch erforderlich sein, vergleichsweise kleinräumige Unterschiede in den Lebensraumbedingungen zu berücksichtigen.
Die Erstellung bzw. Aktualisierung der Wildartenlisten setzt ein regelmäßiges Monitoring voraus, vor allem für gefährdete, sensible und für wiederkehrende Wildarten (siehe Begriffsdefinition). Dazu kann der Jäger durch systematische Beobachtungen und Aufzeichnungen, in Verbindung mit seinen lokalen naturräumlichen Kenntnissen, einen wichtigen Beitrag leisten.
Umgang mit wiederkehrenden Arten (entsprechend dem potenziellen natürlichen Wildarteninventar)
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Als wiederkehrende Arten (siehe Begriffsdefinition) werden in einem bestimmten Gebiet einheimische Wildarten bezeichnet, deren Populationen vorübergehend erloschen waren und die nun ohne oder mit menschlicher Unterstützung wieder ihre ursprünglichen Lebensräume besiedeln. Dies kann durch Wiedereinwanderung oder durch gezielte Wiedereinbürgerung erfolgen. Das Vorhandensein bestimmter Wildarten lässt Rückschlüsse auf die menschlichen Einflüsse im Wildlebensraum, unter anderen auch auf die Jagd, zu. Vorrangig sind hier gefährdete und sensible Wildarten zu nennen, die als Bioindikatoren für die wildökologische Lebensraumqualität und deren jagdliche Beeinflussung gut geeignet sind. Dabei ist nicht nur eine Nichtbeeinträchtigung dieser Arten durch die Jagd zu prüfen, sondern auch, ob häufige und nicht gefährdete Prädatoren, die mangels natürlicher Feinde bzw. durch Seuchenbekämpfung (z. B. Fuchs durch Tollwutimpfung) hohe Bestände aufbauen, effizient im Sinne einer Förderung seltener wiederkehrender Arten (in der Regel Rote-Liste-Arten) bejagt werden, ohne diese selbst zu gefährden (z. B. durch Fallen). Nicht außer Acht zu lassen ist dabei, dass „Nutzen“ im Sinne der Optimierung des potenziellen Wildarteninventars auch dadurch entstehen kann, dass bestimmte wiederkehrende heimische Wildarten andere unerwünschte (nicht autochthonen) Arten verdrängen.
Die jagdliche Förderung einer potenziellen natürlichen Wildart soll zum Ziel haben, langfristig lebensfähige und landeskulturell verträgliche Populationen der betreffenden Art zu ermöglichen, ohne dabei andere heimische Arten in ihrer Überlebensfähigkeit oder langfristigen nachhaltigen jagdlichen Nutzbarkeit zu gefährden.
Umgang mit Wildarten, die nicht im potenziellen natürlichen Wildarteninventar enthalten sind
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Durch unterschiedliche Ursachen können nicht einheimische (nicht autochthone, gebietsfremde, faunenfremde) Arten in Lebensräume gelangen: gezielte Einbürgerung, unabsichtliche Einschleppung, direkt oder indirekt (z. B. durch Lebensraumveränderung) menschlich begünstigte Einwanderung, Flucht aus Gehegen oder Pelztierfarmen, etc. Als nicht einheimische „Neubürger“ oder Neobiota (siehe Begriffsdefinition) werden jene Arten definiert, die erst nach dem Jahr 1492 unter direkter oder indirekter Mithilfe des Menschen in ein Land gelangt sind. Das Jahr 1492 markiert die Entdeckung des amerikanischen Kontinents (durch Christoph Kolumbus) und steht für die seither verstärkten Fernhandelsbeziehungen, wodurch die Anzahl absichtlich oder unabsichtlich eingebrachter Arten sehr stark anstieg. Etwa ab diesem Referenz-Zeitpunkt existieren auch einigermaßen verlässliche Dokumentationen der Faunenveränderung. Da die Natur selbst keine Schwellenwerte kennt, ist eine solche Grenzziehung natürlich stets eine Frage der wissenschaftlichen Übereinkunft. Jene Tierarten, die sich unter Mitwirkung des Menschen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters (1492) etabliert haben und jagdlich nicht relevant sind (z.B. Wanderratte), brauchen daher hier nicht berücksichtigt zu werden.
Aufgrund mangelnder Anpassung, höherer Konkurrenzkraft, fehlender natürlicher Feinde und Einschleppung von Krankheiten verdrängen nicht autochthone Arten häufig autochthone Arten und haben dann gleichzeitig oft einen langfristigen, im Vorhinein nur schwer abschätzbaren Einfluss auf den Wildlebensraum. Ihre jagdliche Duldung oder gezielte Förderung ist daher nicht im Sinne des angestrebten, möglichst vollständigen potenziellen natürlichen Arteninventars von Flora und Fauna. Dokumentiert wird der Umgang mit nicht autochthonen Wildarten beispielsweise durch Trophäen (Balg / Waschbär, Schnecken / Mufflon, etc.) oder auch Hegemaßnahmen (z. B. Fütterung von Muffelwild wo nicht einheimisch).
Einige Wildarten wurden – mehr oder weniger vereinzelt – bereits vor dem oben definierten Zeitraum als Jagdwild eingebracht, haben sich aber nach derzeitigem Wissensstand damals nicht in freier Wildbahn etabliert . So wurde der aus Asien stammende Fasan (Phasianus colchicus) in Südeuropa bereits in römischer Zeit, in Mittel- und Westeuropa etwa ab 1000 n. Chr. gebietsweise als Jagdwild eingebürgert. Beispiel Österreich: Erste Hinweise auf Vorkommen in Österreich stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, wobei allerdings angenommen wird, dass es sich dabei um Fasanerievögel und nicht um frei lebende Vögel gehandelt hat. Erst deutlich später konnte sich die Art durch starke jagdliche Förderung (Hege, regelmäßige Neuaussetzungen) etablieren. Heute verfügt der Fasan über sich in Freiheit fortpflanzende Brutpopulationen, die in klimatisch begünstigten Tieflagen zumindest mittelfristig ohne Hegemaßnahmen zur Selbsterhaltung befähigt sind. Nach obiger Definition ist der Fasan in Österreich als nicht einheimischer „Neubürger“ einzuordnen.
Bei der Anwendung des vorliegenden Indikators sollte der jagdliche Umgang mit dem Fasan differenziert und gebietsweise beurteilt werden. In jenen Wildlebensräumen, wo seine Populationen von selbst überlebensfähig sind, kann der Fasan bei der Bewertung ähnlich wie eine potenzielle natürliche Wildart behandelt werden. Im Sinne des gegenständlichen Kriteriums wäre in der Praxis darauf zu achten, dass in sensiblen Gebieten, wo unerwünschte Konkurrenz gegenüber gefährdeten heimischen Arten (z. B. gegenüber dem Rebhuhn) möglich ist, auf jagdliche Förderung verzichtet wird. Wenn durch wildökologische Gutachten, etc. erwiesen ist, dass eine solche unerwünschte Konkurrenzsituation zu heimischen Arten vorliegt, sollte der Fasan in den betreffenden Gebieten nicht geduldet werden. Dort, wo Fasanpopulationen ohne Hege- oder Besatzmaßnahmen nicht selbsterhaltungsfähig sind, kann diese Art nicht als potenziell natürlich gelten. Eine Ergänzung oder Aufstockung der Fasan-Bestände aus jagdlichen Gründen in der Gegenwart bzw. deren Zucht und Ausbringung für den mehr oder minder unmittelbaren Abschuss in Jagdgebieten wären nach dem Indikator „Einbringung nicht autochthoner Wildtiere“ (siehe Kapitel 1.3.2.1) bzw. nach dem Prinzip: „Die natürliche genetische Vielfalt der Wildarten wird durch eine entsprechende Jagdausübung erhalten und gefördert“ (siehe Kapitel 1.3) zu bewerten. Dies gilt auch für allfällige weitere Wildarten mit ähnlichem Status.
Die Einbringung nicht autochthoner Unterarten oder Standortrassen einer autochthonen Wildart (z. B. Sibirisches oder Kaukasisches Reh, Auhirsch ins Gebirge) ist nach dem Indikator „Einbringung nicht autochthoner Wildtiere“ (siehe Kapitel 1.3.2.1) zu bewerten. Der Umgang mit nicht autochthonen Wildarten wird im Jagdkonzept festgelegt und durch schriftliches Festhalten der durchgeführten Maßnahmen dokumentiert.
Bedachtnahme auf die Ungestörtheit des Lebensrhythmus der Wildtiere
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Jagd wird – v. a. vom Jäger selbst – nur selten als Störfaktor in Betracht gezogen. Der Jagddruck hat jedoch oft starken Einfluss auf das Verhalten der Wildtiere und damit indirekt auf deren Lebensraum. Neben anderen Faktoren führt z. B. beim Schalenwild auch hoher Jagddruck zu einer verminderten Nutzbarkeit der offenen (und meist besten) Äsungsflächen, woraus eine verstärkte Verbissbelastung der Deckung bietenden Waldvegetation resultiert. Die gezielte jagdliche Förderung der Ungestörtheit des Lebensrhythmus der Wildtiere wird im Jagdkonzept entsprechend dokumentiert. Die Festlegung von störungsarmen Bereichen soll sich an einer Wildökologischen Raumplanung (siehe Begriffsdefinition) gebietsübergreifend betrachtend orientieren.
Nachtjagd führt zur zusätzlichen Beunruhigung des Wildes auch während der Nachtstunden, wodurch Raumnutzung und Ernährungsrhythmus der Tiere gestört und auch Wildschäden an der Waldvegetation sowie in Siedlungsgebieten ausgelöst werden können. Bei häufiger Nachtjagd wird auch die Bejagbarkeit der in der Nacht bejagten Arten erschwert, bedingt durch erhöhte Scheuheit des Wildes. Zudem erschwert die Nachtjagd die selektive Wildbejagung, wodurch es irrtümlich zu Abschüssen „falscher“ – unter Umständen sogar geschonter oder nicht jagdbarer – Arten kommen kann. Andererseits kann für die erforderliche Regulierung mancher Arten, vor allem bei Schwarzwild, auf eine zusätzliche Jagd in der Nacht (z. B. an einer Kirrstelle) in manchen Gebieten nicht verzichtet werden. Durch wenige effektive Nachtjagdtage, welche gut gewählt an erfolgsversprechenden Tagen (Sicht bedingt durch Wetter, Wind etc..) durchgeführt werden, können Nachtjagden aber gesamt betrachtet sogar den Jagddruck auf das Wild reduzieren. Dies ist dann der Fall, wenn die jährliche Jagdstrecke in wenigen Ansitzen/Treiben erfüllt wird und in der überwiegenden Zeit des Jahres Jagdruhe im Gebiet herrscht. Ausgenommen davon sind jedenfalls bewusste Nachtjagden zur Vergrämung von z.B. Schwarzwild zur Schadensabwehr.
Zusätzlich sollen Jäger ihre fachliche und ortskundige Kompetenz durch aktive und konstruktive Teilnahme an Planungen von anderen Landnutzermaßnahmen einsetzen (z.B. Lenkung von Erholungssuchenden durch Schaffung attraktiver Angebote in saisonal unbedenkliche Gebiete), um zusätzliche Beunruhigungen zu verhindern.
Berücksichtigung der Reproduktionsbiologie gefährdeter und sensibler Wildarten
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Der falsche Zeitpunkt der Bejagung der einzelnen Wildart, bestimmter Sozialklassen oder Individuen einer Art (Beispiel Waldschnepfe: Bejagung der Weibchen) kann enormen Einfluss auf die Reproduktion einer Wildart haben. Berücksichtigt die Jagdausübung heikle Faktoren der Reproduktionsbiologie bestimmter gefährdeter und sensibler Wildarten durch jagdliche Rücksichtnahme, so ist dies als nachhaltiger Ansatz der Jagdausübung zu werten. Die Betonung liegt dabei auf gefährdeten und sensiblen Wildarten (siehe Begriffsdefinition), die im Wildarteninventar oder auf einer separaten Liste ersichtlich sind.
Die Paarungszeit von Schalenwildarten ist damit nicht gemeint, sehr wohl aber deren Jungenaufzuchtzeit. Es ist auch darauf zu achten, dass bei der Bejagung einer Art nicht die Reproduktionsphasen anderer Wildarten maßgeblich beeinträchtigt werden. Die gezielte jagdliche Berücksichtigung der sensiblen Faktoren der Reproduktionsbiologie der Wildarten wird im Jagdkonzept entsprechend dokumentiert.
Existenz revierübergreifender Bejagungsrichtlinien
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Wildtiere kennen keine Revier-, Landes oder Staatsgrenzen. Die Bejagung der Wildtiere muss sich daher an ihrer Lebensraumnutzung und nicht an den vom Menschen gezogenen Reviergrenzen orientieren. Durch revierübergreifende Bejagungsrichtlinien (jegliche Grenzkonstellationen mit eingeschlossen) kann der Lebensraumnutzung der Wildtiere jagdlich am besten entsprochen werden. Dies gilt v. a. für großräumig agierende Wildarten wie z. B. Rotwild, Schwarzwild, Zugvogelarten. Je kleiner die Reviere sind, umso erstrebenswerter sind revierübergreifende Bejagungsrichtlinien für alle bejagten Wildarten. Dies kann durch die Bildung von Hegegemeinschaften gefördert werden, kann jedoch bei gutnachbarschaftlichen Beziehungen auch völlig formlos durch eine entsprechende Absprache funktionieren. Als besonders nachhaltig ist die revierübergreifende Einrichtung von Wildruhezonen, aber auch von revierübergreifend organisierten Bejagungsformen (z. B. Bewegungsjagden) zu werten. Jede Form einer revierübergreifenden Bejagungsstrategie sollte schriftlich dokumentiert werden.
Bejagung von schwachem und krank erscheinendem Wild
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Krankheiten können eine Vielfalt von Symptomen und Erscheinungen beim Wild hervorrufen, die oft schon beim Ansprechen erkennbar sind. Beispielsweise können ein auffälliges Verhalten eines Stückes, starkes Abkommen, Kotverschmutzung an Spiegel und Hinterläufen als Zeichen für Durchfall, sowie Tränenfluss oder Schaum vor dem Äser Anzeichen für Erkrankungen sein. Diese Stücke können ein Erregerreservoir darstellen und in weiterer Folge andere Stücke anstecken. Deshalb sollte eine erhöhte Aufmerksamkeit auf schwaches und krank erscheinendes Wild gerichtet und dieses bevorzugt und so rasch wie möglich dem Bestand entnommen werden. Im Interesse der Gesunderhaltung des Wildbestandes sollten diese Abschüsse (mit eventueller behördlicher Bewilligung) ganzjährig und über den Abschussplan hinaus erfolgen.
Umgang mit erlegtem gesundem Wild
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Auch erlegtes gesundes Wild kann Träger von Krankheitserregern sein die keine oder nur sehr geringe, beim Ansprechen und beim Aufbrechen erkennbaren, Veränderungen am Tierkörper hervorrufen. Deswegen ist zusätzliches Wissen über Krankheiten und deren Erscheinungsbilder beim Wild sinnvoll, um ein frühestmögliches Erkennen von Wildkrankheiten zu gewährleisten. Zusätzlich kann dies auch zu einer Verbesserung der allgemeinen Wildbrethygiene führen, mit der sich in Folge ein positiver Effekt durch ein verstärktes Vertrauen der Verbraucher ergibt. Die Ausbildung möglichst vieler Angehörigen einer Jagdgesellschaft zur „Kundigen Person“ (EU-Lebensmittelhygienerecht) oder ähnlicher Fachausbildung und das regelmäßige Besuchen von fachspezifischen Fortbildungen können so einen positiven Beitrag zum allgemeinen Gesundheitsstatus des Wildes leisten. Falls die Ursachen von Veränderungen am Wild nicht eindeutig sind, muss auf jeden Fall eine weitere Abklärung entsprechend der Vorschriften erfolgen. Dies kann durch den örtlichen Tierarzt oder auch durch spezialisierte Untersuchungsstellen erfolgen.
Ursachenfeststellung bei Fallwild und erlegtem krankem Wild
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Das Auftreten von Fallwild im Revier kann vollkommen natürlich sein und unterschiedlichste Gründe haben. Diese reichen von Straßenfallwild über Lawinenopfer bis hin zu seuchenhaften Krankheitsgeschehen. Eine genaue Dokumentation bezüglich des zeitlichen und örtlichen Auftretens von Fallwild kann zumindest einen groben Überblick über ein eventuell gehäuftes Fallwildvorkommen geben. Falls die Ursachen für Fallwild nicht eindeutig sind, sollte auf jeden Fall eine genauere Abklärung erfolgen. Dies kann durch kundige Personen, den örtlichen Tierarzt oder auch durch spezialisierte Untersuchungsstellen erfolgen.
Ähnliches gilt für den Umgang mit erlegtem krankem Wild. Hier sollte bei unklaren Ursachen jedenfalls ohne Verzögerungen eine genauere Untersuchung durchgeführt werden. Meldungen an Veterinärmedizinische Behörden/Seuchenschutzbehörden können so zu möglichst raschen Maßnahmen gegen eventuell aufkommende Epidemien/Seuchen beitragen.
Entsorgung von Aufbrüchen sowie von Fallwild
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Das Ausbringen von Aufbrüchen, auch die von augenscheinlich gesund erlegtem Wild, auf Luderplätze bzw. das Liegenlassen an der Aufbrechstelle kann ein Risiko für den allgemeinen Gesundheitsstatus der Wildpopulation darstellen. Einerseits kann das längere Liegenlassen an einem Luderplatz zu einem verstärktem Wachstum von Bakterien am Aufbruch führen und so zu einer Kontamination des Bodens und ev. zu einer Gefährdung der Gesundheit für das Wild werden, das den Aufbruch aufnimmt. Andererseits tragen auch gesund erscheinende Aufbrüche immer ein Restrisiko, Krankheitserreger (z.B. Parasiten im Darm, Lungenwürmer) zu beherbergen, die durch die Aufnahme des Aufbruchs durch anderes Wild weiterverbreitet werden können. Idealerweise sollten deshalb keine Aufbrüche an der Aufbrechstelle oder am Luderplatz liegen gelassen werden, sondern sind hygienisch richtig zu entsorgen (z.B. Tierkörperbeseitigungs-Sammelstellen). Allerdings ist dies gerade in Gebirgslagen nicht immer möglich, da dies mit einem ziemlichen Aufwand verbunden sein kann. Hier kann das Vergraben der Aufbrüche – wo möglich - eine gewisse Abhilfe schaffen, um eine Kontamination von anderem Wild zu verhindern. Nichtentsorgte, unbedenklich erscheinende Aufbrüche und Fallwild können andererseits wieder für Arten positiv sein, welche dies als Nahrungsquelle nutzen (Geier, Fuchs, Kleinstlebewesen...). Die richtige Vorgehensweise soll mit Nutzen/Risiko Einschätzung abgewogen werden.
Bedenklich ist vor allem das Liegenlassen von augenscheinlich durch Krankheiten gefallenem Wild. Hier besteht ein hohes Risiko der Ansteckung für andere Stücke bzw. anderes Wild. Auf diesem Weg kann es zu einer Weiterverbreitung und Einschleppung von Krankheiten kommen. Deshalb sollte Fallwild auf jeden Fall hygienisch einwandfrei bei Tierkörperbeseitigungs-Sammelstellen entsorgt werden.
Existenz trophäenästhetischer Vorgaben in Abschussrichtlinien
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Förderung der innerartlichen genetischen Vielfalt kann auch daran gemessen werden, wie die Bejagung auf diese eingeht. Abschussrichtlinien für das Schalenwild sind daher dahingehend zu bewerten, ob sie die Vielfalt der möglichen Geweih- und Gehörnformen fördern, akzeptieren oder ob sie an trophäenästhetischen Aspekten orientiert sind.
Selektive Bejagung von Wildtieren mit bestimmten natürlichen Merkmalen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Äußere Erscheinungsformen wie Geweihe und Gehörne sowie natürliche Verhaltensweisen haben (oder hatten) einen unterschiedlichen Zweck. So ist aus biologischer Sicht z. B. bedeutsam, ob eine Geweih- oder Gehörnform zur Abwehr von Feinden, zum Imponieren von weiblichen Artgenossen, zum Kampf mit Artgenossen, zum Freilegen der Nahrung im Winter, etc. dient oder nicht.
Die Ästhetik der Trophäen fasziniert den Jäger schon lange. So hat sich (v. a. in der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) eine Idealvorstellung der Trophäe, v. a. von Reh, Gams und Hirsch, entwickelt. Beim Hirsch sind dies endenreiche, weitausgelegte Geweihe, beim Reh ist meist ein massereicher, gut geperlter Sechser die Idealvorstellung, bei der Gams weitausgelegte und möglichst hohe Krucken. Manche, aus trophäenästhetischer Sicht unerwünschte Geweih- oder Gehörnformen können jedoch aus ökologischer Sicht sehr wohl vorteilhaft für das betreffende Tier sein. So sind z. B. eng stehende Trophäen im Kampf durchaus vorteilhaft. Auch eine geringe Endenzahl bei Reh und Hirsch hat keinerlei Nachteile für den Geweihträger, sofern diese nicht Ausdruck schlechter Konstitution ist. Jede Form der selektiven Bejagung, die genetische Auswirkungen haben kann und damit die Gefahr einer genetischen Verarmung der Wildpopulation in sich birgt, sollte vermieden werden.
Eine andere Gefahr der „selektiven Bejagung von Wildtieren“ besteht bei Raufußhühnern. Bei der Frühjahrsbejagung von Auerwild werden oft selektiv die so genannten „Raufer“ am Balzplatz erlegt, mit der Begründung, dass diese durch ihr aggressives Verhalten den Balzbetrieb stören. In Wirklichkeit sind dies zumeist die so genannten Alpha-Hähne, eben die stärksten Hähne, von denen sich die Hennen bevorzugt treten lassen. Beim Auerwild wird durch den Abschuss der Alpha-Hähne vor dem Tretzeitpunkt eine Fortpflanzung gezielt verhindert.
Ob die praktizierte Bejagung in diesem Sinne selektiv ist oder nicht, wird z. B. durch die vorliegenden Trophäen, Präparate, etc. eines längeren Zeitraumes – z. B. einer Jagdperiode – dokumentiert.
Einbringung nicht autochthoner Wildtiere
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Als „nicht autochthon“ sind jene Arten, Unterarten und Standortrassen zu bezeichnen, die in einem bestimmten Gebiet nicht einheimisch sind oder waren (gebietsfremde oder faunenfremde Arten). Dies umfasst alle Wildarten, die nicht zum potenziellen natürlichen Wildarteninventar eines Wildlebensraumes gehören (siehe Begriffsdefinition). Insbesondere sind damit Wildtiere derjenigen Arten gemeint, die – nach einer derzeit mehrheitlich geteilten Übereinkunft in der diesbezüglichen wissenschaftlichen Literatur – erst nach dem Referenzjahr 1492, dem Jahr der Entdeckung des amerikanischen Kontinents, unter direkter oder indirekter Mithilfe des Menschen in ein Land gelangt sind. Die Wiederansiedlung ursprünglich heimischer Arten des potenziellen natürlichen Wildarteninventars, die zeitweilig ausgerottet waren oder deren Populationen vorübergehend erloschen sind, ist mit diesem Indikator nicht gemeint (siehe Kapitel 1.2.1.2). Die Einbringung nicht autochthoner Wildtiere ist v. a. in zwei Formen bekannt:
1. die Einbringung (erstmalig oder Populationsaufstockung) einer nicht autochthonen Wildart (z.B: Mufflon, Damhirsch, Sikahirsch, Chukarhuhn in Ländern wo nicht heimisch) (siehe Kapitel 1.2.1.3),
2. die Einbringung nicht autochthoner Unterarten oder Standortrassen einer autochthonen Wildart (z. B. Wapiti, Maralhirsch, Sibirisches oder Kaukasisches Reh in Mitteleuropa; Auhirsch ins Gebirge, etc.).
Ad 1 ist festzuhalten, dass neu eingebrachte, nicht autochthone Arten häufig autochthone Arten (zumindest aus Teillebensräumen) verdrängen und gleichzeitig oft einen nachhaltigen – und im Vorhinein nur schwer abschätzbaren – Einfluss auf den Wildlebensraum haben (Wildschäden, Übertragung neuer Krankheiten und Parasiten).
Ad 2 ist festzuhalten, dass gerade diese eingebrachten Wildtiere zeigen, dass sich eben in der Entwicklungsgeschichte der Wildtiere ganz spezifisch den lokalen Klimaten und (saisonalen) Nahrungsbedingungen angepasste Unterarten oder Standortrassen entwickeln, die dann auch genau dort hingehören, wo sie sich entwickelt haben. Eine Vermischung von Erbgut durch die Hybridisierung von Unterarten bewirkt eine letztlich irreversible genetische Verfälschung und kann zum Verlust lokaler heimischer Rassen und sogar heimischer Arten führen (z. B. durch veränderte Brutzeiten beim Federwild). Abgesehen davon, dass derartige „Aufartungsversuche“ (v. a. aufgrund zu geringer Individuenzahl) häufig nicht gelingen, können sie auch Qualen verursachen, da heimische Muttertiere die übergroßen Kälber oder Kitze aus Kreuzungen mit größeren Artverwandten nicht setzen können.
Jede Form der Einbringung nicht autochthoner Wildtiere ist daher im Sinne der nachhaltigen Erhaltung und Förderung der (natürlichen) genetischen Variabilität von autochthonen Wildtieren abzulehnen.
Existenz einer Vermarktungsstrategie für die Jagd
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Für die jagdlichen Erträge maßgeblich ist, ob sich der Jagdinhaber damit auseinander setzt, in welcher Form er die Jagdausübung (Verpachtung, Abschüsse, Trophäen – dazu zählen nicht Wildprodukte) vermarktet. So z. B. ob und in welcher Form er diese verkauft oder auch selbst verwertet. Die Vermarktung von Wildbret wird mittels „Indikator 29: Vermarktung von regionalen Wildbretprodukten“ bewertet und ist von der Anwendung dieses Indikators ausgenommen.
Vermarktung von regionalen Wildbretprodukten
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Durch den Konsum von Wildbret kommt ein erheblicher Anteil der nicht jagenden Bevölkerung indirekt mit der Jagd in Kontakt. Eine gezielte Vermarktungsstrategie für Wildbret kann dazu beitragen, dem Wildbret ein gutes Image und der Jagd erhöhte Akzeptanz in der Gesellschaft und damit nachhaltigen Bestand zu verschaffen. Dabei stehen die Qualität der Produkte und die Gesundheit der Konsumenten im Vordergrund. Das Produkt sollte sich von den Massenprodukten im Supermarkt abheben und Bewusstseinsbildung über Vorteile von Wildbret schaffen. Eine Erfolg versprechende Option wäre z. B. freiwilliger Verzicht auf bleihaltige Jagdmunition (Schrot wie Kugel). Dadurch hätte der Konsument die Garantie für besonders hochwertige Wildbretqualität. Durch Schaffung eines regionalen Wildbret-Labels können derartige Besonderheiten transportiert, die Identifikation des Konsumenten mit Produkt und Herkunftsort verstärkt und eine nachhaltige regionale Entwicklung gefördert werden.
Aufwands-/ Ertragsverhältnis (gilt für Verpächter und Eigentümer)
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Dieser Indikator ist von Verpächtern bzw. Eigentümern eines Jagdgebiets (Grundeigentümer, nicht jagdausübende Besitzer einer Eigenjagd) zu bewerten. Aus der Sicht des Verpächters sind unter „Aufwands-/ Ertragsverhältnis“ alle monetär ansetzbaren Aufwendungen und Erträge des Jagdbetriebs zu subsumieren, einschließlich des mit dem Pachtverhältnis unmittelbar zusammenhängenden Zeit- und Arbeitsaufwandes. Ideelle Aspekte gehen in diesem Fall nicht in die Bewertung ein.
Als „Aufwand“ sind alle Kosten an Geld, Material und Zeit anzurechnen. Dies umfasst z. B.: Mehraufwand durch Wildschäden (Wildschutzmaßnahmen an Kulturen, Behebung von Wildschäden), land- oder forstwirtschaftliche Ertragsverluste durch Wildschäden, eventuell anfallende Personalkosten, Aufwand für Kommunikation (mit dem Pächter) und Organisation (Vertragserstellung, Kontrolle, etc.). Eventuell – je nach Pacht- oder Abschussvertrag – können auch Kosten für Errichtung und Instandhaltung von Reviereinrichtungen und Infrastruktur (z. B. Wege), Fütterungskosten, etc. anfallen. Bei den „Erträgen“ sind v. a. anzusetzen: Pachterlöse, Abschusserlöse, Wildschadenabgeltungen.
Verhältnis Aufwand / subjektiver Nutzen (gilt für Jagdpächter und Jagdkunden)
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Dieses Indikator ist von Pächtern eines Jagdgebiets und Jagdkunden (Abschussnehmer, Pirschgänger, etc.) zu bewerten. Auch Eigenjagdbesitzer, die in ihrem eigenen Jagdgebiet die Jagd selbst ausüben, werden sich eher nach diesem Indikator als nach „Indikator 30: Aufwands-/ Ertragsverhältnis (gilt für Verpächter und Eigentümer)“ siehe 2.1.1.3 beurteilen.
Aus der Sicht von Jagdpächtern und Jagdkunden ergibt sich das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen, indem die materielle und ideelle Bilanz aus allen eingesetzten und erlösten Mitteln (materielle Aspekte) und dem subjektiven Nutzen gebildet wird. Unter dem subjektiven Nutzen ist neben monetären Erlösen vor allem der subjektive ideelle Gewinn (immaterielle Werte) anzusetzen und mit dem Aufwand abzuwägen.
Als „Aufwand“ anzurechnen sind z. B. Kosten und Aufwendungen für: Pachtpreis bzw. Abschusslizenz, Steuern und Abgaben, Jagdkarte, Kosten für Fütterung und Kirrung, Reviereinrichtungen, Wildschadenabgeltungen, evtl. Personalkosten, Geräte, Anfahrt, z. T. Jagdzeit (z. B. für Abschusserfüllung), Organisation und Kommunikation (mit dem Verpächter), etc.
Unter dem materiellen und immateriellen „Nutzen“ sind subsumierbar: subjektiver Erholungswert (Freude, Naturerleben, z. T. Jagdzeit, etc.), Wildbret und Wildbreterlöse, Abschussverkäufe, Imagewerte, Geschäftsabschlüsse, etc.
Solange die Summe aus ideellem Gewinn und materiellen Erträgen die Kosten an Geld, Material und Zeitaufwand überwiegt und ein subjektiver Nutzen aus der Jagd gezogen wird, ist die Bilanz aus Sicht des Pächters bzw. Jagdkunden positiv.
Jagdliche Maßnahmen zur Förderung des Marktwertes
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Beurteilung dieses Indikators ist insbesondere aus der Sicht des Jagdberechtigten (Eigentümer, Verpächter, Eigenjagdbesitzer) sinnvoll.
Abgesehen vom Einfluss des durchschnittlichen örtlichen Marktwertes (Lagefaktoren wie Stadtnähe oder reizvolle Landschaft) resultiert der angenommene oder tatsächlich erzielbare Marktwert einer Jagd v. a. aus dem Wildartenreichtum einer Jagd, Gesundheitszustand des Wildes, den erzielten Strecken, der Besonderheit der Trophäen und der Bejagbarkeit (Erreichbarkeit, Erschließung und Zugänglichkeit, Revierausstattung). All diese Faktoren sind durch das Management einer Jagd – in Abhängigkeit von ihrer Flächengröße – im positiven wie auch im negativen Sinne beeinflussbar.
So kann z. B. unter dem Stichwort „Kundenfreundlichkeit“ durch besonders gute Betreuung (zahlender) Jagdgäste das Image und damit auch der Wert einer Jagd gesteigert werden. Auch die gezielte Förderung nicht häufiger Wildarten, die dann einen bestandsverträglichen Abschuss nicht alltäglicher Trophäenträger zulässt, kann eine Maßnahme zur Förderung des Marktwertes sein. Ebenso ist meist eine gute Infrastruktur bei den Reviereinrichtungen (Jagdhütten, Pirschsteige, Hochsitze, Schirme, etc.) ein nicht unwichtiger Faktor für den Marktwert einer Jagd. Hinweis: Es kann vorkommen, dass jagdliche Maßnahmen, die zur Förderung des Marktwertes beitragen, gleichzeitig negative Auswirkungen bei den ökologischen Nachhaltigkeitsanforderungen haben – z. B. eine übermäßig intensive Wildbewirtschaftung, die zu unnatürlich hohen Wildbeständen mit landeskulturell unverträglichen Wildeinflüssen auf die Vegetation führt.
Existenz eines ökonomisch fundierten, zeitlichen und räumlichen Bejagungskonzepts
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Aus ökonomischer Sicht ist eine Bejagungsstrategie zur zeitlichen und räumlichen Durchführung der Bejagung insbesondere für die Effizienz der Bejagung, für die erzielbaren Wildbretgewichte, für die Höhe eventueller Fütterungskosten sowie für die Vertrautheit der Wildtiere wichtig.
Für die Effizienz der Bejagung ist wichtig, dass in die Bejagungsstrategie das Wissen über saisonale Aufenthaltsorte und die Zeit der größtmöglichen Beobachtbarkeit einer Wildart Eingang finden und damit der jagdliche Zeitaufwand minimiert werden kann. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass dies nicht kontraproduktiv zu geplanten Schwerpunktbejagungen ist (z.B. gezielte jagdliche Aktivitäten an schadensanfälligen Flächen, ggf. auch bei geringerer Abschusswahrscheinlichkeit).
Die Planung der zeitlichen und räumlichen Bejagung wird als wesentlicher Bestandteil einer ökonomisch fundierten Bejagungsstrategie im Jagdkonzept dokumentiert. Die zeitliche Durchführung der Bejagung soll in Abschusslisten nachvollziehbar sein. Die räumliche Durchführung der Abschüsse soll auf einer Revierkarte, getrennt nach Jagdjahr, durch Markierung jedes Einzelabschusses ersichtlich sein oder bei Bewegungsjagden (Niederwild) durch Kennzeichnung der jeweiligen Gebiete.
Berücksichtigung der Wildschadenanfälligkeit
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Eine Vermeidung von Wildschaden kann dadurch bewirkt werden, dass die Jagdausübung an der Wildschadenanfälligkeit land-, forst- und fischereiwirtschaftlicher Kulturen bzw. anderer Naturgüter (z. B. Orchideenwiesen, Magerrasen) orientiert ist. Dies sollte durch eine räumliche und zeitliche Berücksichtigung absehbarer land-, forst- und fischereiwirtschaftlicher Einflüsse auf den Lebensraum im Jagdkonzept dokumentiert werden (z. B. Schwerpunktbejagung).
Bestätigung einer gemeinsamen Vorgangsweise
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Grundvoraussetzung für die Bildung einer ökonomischen Einheit mit anderen absehbaren anthropogenen Nutzungen ist regelmäßiger Kontakt und Absprache mit den anderen Landnutzern bzw. deren Interessenvertretern. Dokumentiert wird die Bildung einer ökonomischen Einheit durch die Bestätigung einer gemeinsamen wirtschaftlichen Vorgangsweise durch die anderen Landnutzer bzw. deren Interessenvertreter im Jagdgebiet.
Engagement der Jäger für eine interdisziplinäre wildökologische Raumplanung (WÖRP)
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Die wildökologische Raumplanung (WÖRP - siehe Begriffsdefinition) ist ein Instrument für ein integratives Management von Wildtierpopulationen und -habitaten, das der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den Lebensraumansprüchen von Wildtieren, der Tragfähigkeit von Ökosystemen für Wildtierpopulationen und den unterschiedlichen Nutzungsinteressen der Gesellschaft (Jagd, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, allgemeine Raumplanung) dient. Neben der Erhaltung der Lebensräume heimischer Wildtierarten und der Gewährleistung von deren nachhaltiger jagdlicher Nutzbarkeit bilden die Vermeidung von Nutzungskonflikten und von untragbaren Wildschäden am Wald übergeordnete Ziele. Neben einer rechtsverbindlichen Verankerung kann eine WÖRP auch freiwillig auf regionaler Ebene und auf Basis der Eigeninitiative der Jagdausübenden durchgeführt werden. Die Einbeziehung einer WÖRP in die allgemeine Landesraumplanung sollte angestrebt werden.
Eine WÖRP muss jedoch zumeist von Seiten der Jäger angeboten bzw. eingefordert werden. Dahingehende Bestrebungen des Jagdinhabers und der Jägerschaft sollten entsprechend dokumentiert werden.
Engagement der Jäger bei Planungen und Projekten mit Auswirkungen auf den Wildlebensraum
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Als Kenner ihres Jagdgebiets und als Experten vor Ort sind Jäger aufgefordert, ihre Revierkenntnisse und ihr wildökologisches Wissen in Planungen und Projekte, die mit möglichen Beeinträchtigungen der Wildlebensräume verbunden sind, einzubringen. Damit kann ein wertvoller Beitrag geleistet werden, um nicht nur wildökologische Verschlechterungen, sondern auch Beeinträchtigungen des Jagdbetriebs, der praktischen Bejagbarkeit und des wirtschaftlichen und ideellen Jagdwertes zu vermindern oder zu vermeiden.
Ein Beispiel sind Straßenbauprojekte, die neben der wildökologischen Trennwirkung auch zur Zerschneidung von Jagdgebieten, zur jagdwirtschaftlichen Entwertung abgetrennter Revierteile und zur Minderung des Erholungswertes der Jagd führen können. Bei Straßenneubauten ist die örtliche Jägerschaft meist die erste und wichtigste Informationsquelle für die Beurteilung jagdlicher und wildökologischer Projektwirkungen (siehe auch 1.1.3.2). Bürgerbeteiligungsverfahren im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen bieten weitere formalisierte Möglichkeiten, zu Projekten Stellung zu beziehen und in begrenztem Rahmen Einfluss zu nehmen. Gesetzlich vorgesehene ökologische Ausgleichsmaßnahmen zur Minderung negativer Projektwirkungen ermöglichen ebenfalls, jagdliche Interessen zu berücksichtigen (Wildbrücken, Bepflanzungsmaßnahmen, Schaffung von Ersatzbiotopen, etc.). Kommassierungen im Zuge von Agrarplanungen, Schutzwaldsanierungsprojekte, Erstellung von Waldentwicklungs-plänen, größere Waldrodungen oder Aufforstungen, Wald-Weide-Regulierungsprojekte, Widmungen von Betriebsgebieten, Gewässerrückbauten oder Naturschutzprojekte sind weitere Beispiele für lebensraumverändernde Maßnahmen, wo Engagement von Jagdberechtigten und Jagdausübungsberechtigten möglich und im eigenen Interesse sinnvoll ist. Eine wildökologische Raumplanung (WÖRP) (siehe 2.4.2.1) kann dabei als Instrument eingesetzt werden, um jagdliche und wildökologische Interessen gegenüber anderen Planungen zu vertreten. In den meisten Fällen wird es notwendig sein, eine Zusammenarbeit seitens der Jagd aktiv anzubieten bzw. einzufordern, auch wenn keine formelle Parteienstellung besteht.
Nicht gemeint ist bei diesem Indikator ein Engagement der Jäger im Hinblick auf die routinemäßige forstliche Betriebsplanung (Form der Waldnutzung, etc.), die sich ebenfalls maßgeblich auf die Habitatqualität für Wildtiere, die Wildschadenanfälligkeit des Waldes und die Bejagbarkeit des Wildes auswirken kann. Dieser Aspekt bleibt hier außer Betracht.
Interessenausgleich zwischen jagdausübungsberechtigten und nicht jagdausübungsberechtigten ortsansässigen Jägern
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen jagdausübungsberechtigten und nicht jagdausübungsberechtigten ortsansässigen Jägern – einschließlich Abschussnehmern – ist eine wichtige Voraussetzung einer sozio-kulturell nachhaltigen Jagdausübung. Ein solcher Interessenausgleich ist auch für die lokale Akzeptanz der Jagd durch die nicht jagende Bevölkerung wichtig. Dieser Indikator wird durch die Befragung der betroffenen Jäger bewertet. Dies wird dokumentiert.
(Anmerkung: Vor allem mit Blickwinkel „Genossenschaftsjagd“, „Agrargemeinschaften“; bei großen Grundeigentümern mit mehreren Jagdrevieren revierübergreifender Blickwinkel erforderlich).
Angemessene Berücksichtigung nicht ortsansässiger Jäger
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Einheimischen Jägern ausreichende Jagdmöglichkeiten zu gewähren, ist im Sinne der sozio-kulturellen Nachhaltigkeit als ein vorrangiges Ziel zu betrachten (siehe Erläuterung zu Kapitel 3.1.1). Auch kann davon ausgegangen werden, dass die Erfüllung ökologischer Nachhaltigkeitsanforderungen einer guten Kenntnis des bejagten Reviers und der örtlichen naturräumlichen Voraussetzungen bedarf, was durch Ortsansässigkeit begünstigt wird.
Dennoch sollten aber auch die jagdlichen Bedürfnisse von auswärtigen Jägern (Jagdgäste, Jäger ohne eigene Jagdmöglichkeit vor Ort) in angemessener Weise und entsprechend den örtlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten (z. B. in Abhängigkeit von der Reviergröße und dem Abschussplan) Berücksichtigung finden, um diese Gruppe nicht gänzlich von der Möglichkeit zur Jagdausübung auszuschließen. Von auswärtigen Jägern muss hierbei eine fundierte Auseinandersetzung mit den spezifischen lokalen Gegebenheiten erwartet werden; eine sachkundige Einweisung und fachliche Führung durch einheimische Jäger ist dabei vorteilhaft.
Bereitstellung jagdlicher Arbeitsmöglichkeiten
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Arbeit fällt in den Jagdgebieten der verschiedenen Lebensraumtypen in sehr unterschiedlichem Ausmaß an. Sie kann von der Errichtung und Betreuung von Reviereinrichtungen, der Führung von Jagdgästen, einer aufwändigen Reviergestaltung und Biotoppflegemaßnahmen bis zur Organisation von Gesellschaftsjagden und zur regelmäßigen Kontrolle von Fangeinrichtungen reichen. Natürlich ist der Arbeitsumfang auch von der Reviergröße abhängig. Es besteht somit – abgesehen von der in den Bundesländern z. T. unterschiedlich geregelten Verpflichtung zur Einstellung von Berufsjägern – die Möglichkeit der Beschäftigung weiteren jagdlichen Personals, von Vollzeit- bis zu Gelegenheitsarbeitskräften. Die vorrangige Einbindung von einheimischen Arbeitskräften ist unter anderem auch wegen deren Ortskenntnis wünschenswert.
Berücksichtigung von Leitbildern und Managementzielen von naturschutzrechtlich geschützten Gebieten
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Gerade in einem naturschutzrechtlich geschützten Gebiet wird von Seiten der Öffentlichkeit der Art und Weise, wie Naturnutzung – einschließlich der Jagd – stattfindet, erhöhte Aufmerksamkeit entgegengebracht. Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete werden über nationale oder föderale Gesetze geregelt; z.B. finden sich in Landesnaturschutzgesetzen Regelungen zu Europaschutzgebieten (verordnete Natura-2000-Gebiete), Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Natur-Landschaftsschutzgebieten, Naturparks, geschützten Landschaftsteilen und sonstige Schutzgebieten. Zu den naturschutzrechtlich geschützten Gebieten zählen auch Nationalparks, in denen in der Regel die Jagd jedoch nicht im herkömmlichen Sinn durchgeführt wird, sondern in Form eines speziell mit den Schutzzielen des Nationalparks abgestimmten Wildtiermanagements.
Das große öffentliche Interesse an naturschutzrechtlich geschützten Gebieten und seinen Zielen macht einen besonders sorgsamen Umgang mit Wild und Natur sowie verstärkte Rücksichtnahme auf die Interessen anderer Landnutzer notwendig. Indem Jäger die Erreichung der Schutzgebietsziele berücksichtigen und – wo möglich – unterstützen, wird letztlich ein Beitrag dazu geleistet, dass die gesellschaftliche Akzeptanz des jagdlichen Tuns langfristig gesichert und verbessert wird. So sollte die Jagd beispielsweise dazu beitragen, das Ziel einer möglichst natürlichen Waldentwicklung zu unterstützen. Dazu zählt unter anderem ein Umgang mit dem Wald und der Vegetation bei der Schussfeldpflege, der mit dem Ziel der Entwicklung möglichst natürlicher Waldökosysteme verträglich ist. Neben konkreten Managementzielen sollte die Jagdausübung auch weitere Leitbilder und Zielvorstellungen berücksichtigen. Hierzu zählen auch unverbindliche Leitbilder für einzelne Nutzungsformen, die gemeinsam mit Nutzergruppen erarbeitet wurden.
Bestmögliche Berücksichtigung von Schutzzielen, Leitbildern und Managementzielen von naturschutzrechtlich geschützten Gebieten bedeutet für den Jäger gewohnte Verhaltensweisen freiwillig zu ändern oder auf bestimmte Praktiken zu verzichten. Von anderweitigen Managementmaßnahmen, wie örtlicher Beruhigung sensibler Waldökosysteme durch Besucherlenkung, etc., profitieren jedoch letztlich insbesondere auch Jäger und Wildtiere. Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete oder Teile davon, können als Wildruhezonen in das Jagdkonzept integriert werden. Für störungsempfindliche Wildtiere (z. B. Rotwild und Haselhuhn) entwickeln sich attraktivere Habitate; Jäger können angrenzend interessante, wildreiche Jagdgebiete nutzen.
Die Berücksichtigung naturschutzrechtlich geschützter Gebiete bei Bejagungsstrategien, Errichtung und Pflege von Jagdeinrichtungen, Hege etc. wird im Jagdkonzept dokumentiert.
Gestaltung und Verteilung von Reviereinrichtungen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Reviereinrichtungen, v. a. Hochstände, erleichtern die Bejagung. Sie können aber bei auffälliger, landschaftsunangepasster Bauweise, durch auffällige Baumaterialien (z. B. Stahl, Aluminium, etc.) und durch auffällige Verteilung (in der offenen Feldlandschaft befindliche Einrichtungen sind notwendig und geläufig) das Landschafts- und Waldbild ungünstig prägen. Dadurch kann die gesellschaftliche Akzeptanz der Jagd negativ beeinflusst werden.
Dokumentation von Unstimmigkeiten bei der lokalen Behörde
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Es ist generell erstrebenswert, dass die Jagd unter Berücksichtigung anderer sozialer und wirtschaftlicher Bereiche, deren Interessen vor Ort durch die Jagd berührt werden, durchgeführt wird. Ganz besonders gilt dies für Genossenschafts- und Pachtjagden, bei denen der Pächter auf fremdem Grund und Boden jagt. Ob eine solche Berücksichtigung existiert oder nicht, kann durch die Dokumentation von Unstimmigkeiten bei der lokalen Behörde festgestellt werden.
Aktive Einbeziehung und Information nicht jagdlicher örtlicher Interessen- und Landnutzergruppen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Einbeziehung und Berücksichtigung nicht jagdlicher Interessen vor Ort ist gerade in intensiv durch die Bevölkerung genutzten Gebieten essenziell zur nachhaltigen Akzeptanzsicherung der Jagd. Sie kann unter anderem auch daran gemessen werden, ob andere Landnutzer, Interessenträger und gesellschaftliche Gruppen bzw. deren jeweilige Vertreter aktiv zur Zusammenarbeit, zur Koordination oder auch nur zur Information eingeladen werden, um zur gesellschaftlichen Akzeptanz jagdlicher Maßnahmen beizutragen. Dies ist nicht mit einer Mitbestimmung im Sinne eines formellen Stimmrechts in rein jagdlichen Gremien zu verwechseln. Außerdem ist die Mitbestimmung der Grundeigentümer in Fragen der jagdlichen Bewirtschaftung notwendig, um den Interessenausgleich zwischen Grundeigentümern und Jagdausübungsberechtigten zu gewährleisten.
Jede Form der Einbeziehung erfordert regelmäßige Kommunikation zwischen allen Betroffenen und Interessierten, z. B. den Grundeigentümern, Jagdausübungsberechtigten, allen (potenziell) betroffenen Landnutzern sowie der örtlichen Bevölkerung. Durch regelmäßige Absprachen können viele Unstimmigkeiten vermieden, im Vorfeld vermindert oder zumindest rasch nach deren Auftreten bereinigt werden. Beispiele für Akteursgruppen, die in Wechselwirkung mit der Jagd stehen können, sind neben den Grundeigentümern zum Beispiel Forstwirte, Landwirte, Alpin- oder Tourismusvereine, Mountainbikevereine, Reitverbände, Naturschutzorganisationen, Gemeindepolitiker, Straßenverwaltungen bzw. unterschiedlichste Projektbetreiber, aber auch Eigentümer angrenzender Grundstücke und Nachbarreviere sowie auch nachbarschaftlichen Managementeinrichtungen. Zwar können Absprachen auch unregelmäßig und informell erfolgen, jedoch bieten etablierte, organisierte und regelmäßig stattfindende Treffen einen besser geeigneten Rahmen und sind ein Zeichen dafür, dass sich Jäger im Sinne einer guten Diskussionskultur offen und aktiv für ein gutes Gesprächsklima einsetzen. Als organisatorische Instrumente für den Meinungsaustausch und die wechselseitige Abstimmung kommen z. B. in Betracht: Einladungen zu Jagdausschusssitzungen, erweiterte Hegering-Versammlungen, Kommunikationsplattformen, regelmäßige Informations- und Diskussionsveranstaltungen oder auch regelmäßige Stammtische.
Konfliktbewältigungsstrategien
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Dieser Indikator zielt nicht darauf ab, dass es grundsätzlich keine Meinungsverschiedenheiten geben darf. Manchmal bergen Meinungsverschiedenheiten bzw. deren respektvolle und sachliche Austragung kreatives, innovatives und effizientes Lösungspotenzial. Ein Hinweis darauf, ob ein Konflikt lösungsorientiert, sachlich und respektvoll bewältigt wird, ist die Einhaltung einer „Eskalationsstufenleiter“, z. B. indem zuerst das direkte Gespräch gesucht wird (etwa vor Ort oder auch am Wirtshaustisch); als nächste Eskalationsstufe wird eine von allen Seiten akzeptierte außenstehende Person als Moderator hinzugezogen; und erst zuletzt wird der Weg vor Gericht beschritten. Auch bei Konflikten zwischen kleineren Gruppen auf der einen Seite (z. B. Jägern) und größeren Gruppen auf der anderen Seite (z. B. Erholungssuchenden wie Mountainbiker, Geocacher, Paragleiter oder Reiter, etc.) kann dieser Indikator angewandt werden, indem zuständige Interessenvertreter (Stakeholder) der anderen Seite kontaktiert und mit dem jeweiligen Anliegen befasst werden.
Da der generelle grundlegende „Umgang miteinander“ wesentliche Grundlage für Zusammenarbeiten und Kooperationen - welche durch andere Indikatoren beschrieben werden - ist, kommt diesem Indikator demensprechende Wichtigkeit zu.
Gesellschaftliches Engagement der Jäger und regelmäßiger kommunikativer Austausch mit der nicht jagenden Bevölkerung
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Die Häufigkeit, Intensität und Qualität der sozialen Kontakte und des Gedanken- und Meinungsaustauschs mit der nicht jagenden Bevölkerung beeinflussen maßgeblich das Meinungsbild, das Jäger und Nicht-Jäger voneinander haben. Wechselseitige Vorurteile können am ehesten durch regelmäßige Kommunikation abgebaut werden. Dies erfordert Anstrengungen auf beiden Seiten; im vorliegenden Bewertungsset wird ausschließlich das aktive Engagement der Jäger bewertet. Zur Bewertung anderer Landnutzer stehen spezielle Bewertungssets zur Verfügung, etwa für die Land- und Forstwirte oder für Managementverantwortliche im Erholungs- und Tourismusbereich. Geeignete Rahmenbedingungen und Anlässe können den kommunikativen Austausch bedeutend fördern. Als Indiz dafür, wie intensiv Jäger den Kontakt mit der breiteren Gesellschaft pflegen, können z. B. die Häufigkeit von gemeinsamen, im öffentlichen oder halböffentlichen Raum stattfindenden geselligen Veranstaltungen – wie Hubertusfeiern, Informationsstände auf Dorffesten, Wildbretvermarktungsveranstaltungen, wildpädagogische Veranstaltungen, etc. – herangezogen werden. Ein weiteres Indiz sind aktive Mitgliedschaften von Jägern in nicht jagdlichen gesellschaftlichen Gremien, wie Vereinen, politischen Organen, Organisationen, etc. Derartige Aktivitäten bieten die Möglichkeit, jagdrelevante Beiträge zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten und die gesellschaftliche Integration der Jagd zu fördern.
Berücksichtigung der breiteren öffentlichen Meinung
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Auf begründete, sachliche Kritik der Gesellschaft an bestimmten Formen der Jagdausübung sollte eingegangen werden, indem diese bedacht und diskutiert wird. Gesellschaftliche Veränderungen können es erforderlich machen, dass manche traditionellen jagdlichen Praktiken und Denkweisen überdacht werden müssen. Damit ist nicht die Anpassung an Moden und kurzlebige Zeitgeisterscheinungen gemeint, sondern die aktive Auseinandersetzung mit veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, denen sich auch die Jagd nicht entziehen kann. Dies kann z. B. dadurch dokumentiert werden, dass Meinungen der breiteren Gesellschaft, repräsentiert z. B. durch Standpunkte bedeutender Organisationen, in Jagd- oder Hegering-Versammlungen besprochen werden und dies in Sitzungsprotokollen festgehalten wird.
Verzicht auf Alkohol bei der Jagd
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Neben einschlägigen straf- und zivilrechtlichen Bestimmungen bzw. den Folgen von Übertretungen aufgrund von Alkohol-, aber auch von Drogen- und Medikamentenkonsum, gibt es ernste Gründe auf Alkohol bei der Jagd zu verzichten, z. B. die Sicherheit von Menschen im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Jagdwaffen, Gesundheitsaspekte im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, Tierschutzaspekte und auch das positive Bild der Jägerschaft in der breiten Öffentlichkeit, wenn auf Alkohol bei der Jagd verzichtet wird.
Der Verzicht auf Alkohol (entsprechend den einschlägigen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung) kann u. a. unterstützt werden, indem insbesondere bei Gesellschaftsjagden der Jagdleiter im Rahmen der Prüfung der Jagdlegitimationen ein spezielles Augenmerk auf die Prüfung allfälligen Alkoholeinflusses legt. Darüber hinaus kann der Jagdleiter bereits in der Einladung, aber auch vor Ort entsprechend appellieren und freiwillige Alkoholkontrollen mit Hilfe entsprechender Testgeräte anbieten. Letztendlich ist der Jagdleiter rechtlich befugt, Jäger von der Jagd auszuschließen, wenn sie augenscheinlich nicht über die körperliche und/oder geistige Jagdeignung verfügen. Dies gilt neben den Jägern auch insbesondere für sonstige Jagdbeteiligte wie Treiber. Ferner soll auch auf allfällige straf- und zivilrechtliche sowie versicherungstechnische Folgen im Schadensfall hingewiesen werden, im Fall, dass zwar die Grenzen der einschlägigen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung eingehalten wurden, jedoch trotzdem Alkohol- Drogen- oder Medikamentenkonsum vorliegt.
Die freiwillige Verpflichtung zum Verzicht auf Alkohol bei der Jagd, sowohl bei Gesellschaftsjagden, als auch bei der Einzeljagd, umfasst nicht die Zeit nach der Jagd, also z. B. die gesellige Pflege der Jagdkultur, wobei auch hier auf die einschlägigen straf- und zivilrechtlichen Bestimmungen zum Alkoholkonsum und deren Folgen hingewiesen werden muss, insbesondere betreffend Straßenverkehr.
Vertrautheit der Wildtiere
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Wild ist vertraut, wenn es sich gegenüber dem Menschen wenig scheu verhält, wobei artspezifische Unterschiede zu berücksichtigen sind. Die Vertrautheit der bejagten und der nicht bejagten Wildtiere gegenüber dem Menschen ist auch von der jagdbedingten Beunruhigung des Wildes abhängig: je niedriger der Jagddruck, desto höher die Vertrautheit der bejagten und der nicht bejagten Wildtiere. Die Störwirkung anderer anthropogener Nutzungen des Wildlebensraumes wird von der Intensität des Jagddrucks maßgeblich beeinflusst. Ein hohes Maß an Vertrautheit ist für einen möglichst stressfreien Aufenthalt der Wildtiere in den vom Menschen genutzten Bereichen des Wildlebensraumes wichtig und damit auch für die Zugänglichkeit wichtiger Teillebensräume, wie z. B. guter Äsungsflächen im offenen Gelände.
Mit „Vertrautheit“ nicht gemeint ist ein nicht mehr wildtiertypisches Verhalten, das durch übermäßige Gewöhnung an den Menschen entstehen kann (was z. B. „futterzahme“, aber auch aggressive Tiere zur Folge haben kann).
Die Vertrautheit der Wildtiere kann hier naturgemäß nicht als exakter Messwert für jede Wildart angegeben werden. Durch den beobachtenden Vergleich der Vertrautheit der Wildtiere in Revierteilen mit unterschiedlichem Jagddruck, aber auch durch den Vergleich mit dem Verhalten von nicht bejagten Wildtieren, können jedoch für die verschiedenen Wildarten sehr gut anwendbare artspezifische Richtwerte (z.B. Fluchtdistanz) gewonnen werden.
Übertretungen von tierschutzrelevanten Bestimmungen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Dem bejagten Wildtier keine oder geringstmögliche Qualen zuzufügen, sollte ein zentrales Ziel der Jagdausübung sein. Eine tierschutzkonforme Bejagung erfordert die Einhaltung diesbezüglich anzuwendender Bestimmungen der Jagdgesetze (Gebote und Verbote für die Jagd, bestimmte Aspekte der Weidgerechtigkeit, wie z. B. zu Schlingen und Fallen, Munitionsverwendung, Nachsuche, etc.).
Training der Schießfertigkeit
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Einsatz von Gift bei der Jagdausübung
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Aktives Kommunikations- und Krisenmanagement im Falle von jagdrechtlichen Übertretungen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Hinweise zu Übertretungen rechtlicher Vorschriften, die im Zusammenhang mit der Jagdausübung stehen, können sowohl aus der Jägerschaft kommen, aber auch von anderen, etwa Verwaltungsbehörden, wie Bezirksverwaltungsbehörden oder Gemeinden, oder Polizei, Medien etc.
Veräußerung (Weitergabe, Verkauf) von Wildtieren aus Gattern oder Volieren zum Abschuss
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Freilassung von Wildtieren aus Gattern oder Volieren zum Abschuss
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Verbesserung des Wissensstandes über Auswirkungen jagdlicher Maßnahmen auf andere Landnutzungen
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
Jagdliche Aktivitäten können einschränkend auf die Qualität von Nutzungsaktivitäten anderer Interessengruppen (z. B. Freizeit- und Erholungsaktivitäten) wirken. Daher ist es wünschenswert, wenn sich Jagdausübende im Rahmen von interdisziplinär ausgerichteten Aus-, Fort- und Weiterbildungsaktivitäten mit den bewussten und unbewussten Folgen der Jagd auf andere Landnutzungsformen auseinandersetzen und ihren diesbezüglichen Wissensstand regelmäßig aktualisieren. Dies kann durch Aktivitäten, die zu einer qualitativ hochwertigen Wissensvermittlung beitragen, dokumentiert werden. Ein Beispiel hierfür sind regelmäßig besuchte einschlägige Aus- und Fortbildungs¬veranstaltungen (Vorträge, Fachtagungen, Diskussionsveranstaltungen, Exkursionen, etc.), aber auch die Auseinandersetzung mit Fachliteratur – jedenfalls alle Wissensvermittlungs¬angebote, die sich direkt oder indirekt mit den Nutzungsansprüchen anderer Interessengruppen auseinander setzen.
Bei der Anwendung dieses Indikators ist zu beachten, dass auch Bildungsangebote mit allgemein jagdlichem Inhalt wertvolle Hilfestellungen zur Problemlösung bei entgegenstehenden Flächenansprüchen mehrerer Nutzer geben können. Eine Inanspruchnahme solcher Angebote kann daher positiv in die Bewertung eingehen, sofern ein direkter oder indirekter Bezug zu den Bedürfnissen anderer Interessengruppen gegeben ist.
Überprüfung jagdlicher Verhaltensweisen durch regelmäßige Aktualisierung des Wissensstandes
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen
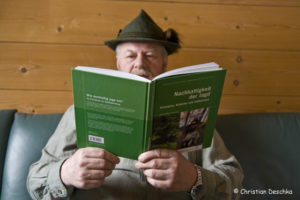
Die Voraussetzung für jede Weiterentwicklung traditioneller Vorstellungen von Jagdethik bzw. Weidgerechtigkeit ist, dass eine regelmäßige Auseinandersetzung mit neuen praxisrelevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und wildbiologischen bzw. jagdkundlichen Forschungsergebnissen stattfindet. Zwar soll sich die Wissenschaft vermehrt um die Weitergabe von Informationen an die Jagdpraxis bemühen, doch besteht diesbezüglich auch eine „Holschuld“ seitens der Jägerschaft, d. h. die Informationen müssen in der Regel aktiv eingeholt werden. Die Verantwortung des Jägers für die ihm anvertrauten Wildtiere erfordert, dass das jeweils beste verfügbare Wissen in die Jagdpraxis umgesetzt wird.
Eine besonders hohe wildökologische, jagdwirtschaftliche und jagdethische Qualifikation ist insbesondere auch für Jagdfunktionäre wichtig. Diese tragen als gewählte Vertreter der Jägerschaft eine große Verantwortung: Sie bestimmen maßgeblich die Jagdausübung in ihrem Zuständigkeitsbereich und sind teils auch in der Lage, auf die Gestaltung von Jagdgesetzen Einfluss auszuüben. Gleichzeitig prägen sie das Bild der Jägerschaft in der Öffentlichkeit – sowohl im täglichen Jagdgeschehen als auch bei Veranstaltungen und in den Medien. Zudem üben sie eine Vorbildfunktion nach innen aus.
Die regelmäßige Aus- und Weiterbildung aller Jagdausübenden ist daher wünschenswert. Diese kann durch alle geeigneten Aktivitäten dokumentiert werden, die zu einer qualitativ hochwertigen Wissensvermittlung beitragen. Beispiele hierfür sind der regelmäßige Besuch von einschlägigen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Vorträge, Jägertagungen, Diskussionsveranstaltungen, Exkursionen, etc.), aber auch die Auseinandersetzung mit Fachliteratur.
Pflege der Jagdkultur
Ihre Antwort
Nicht beantwortet
Weitere Informationen

Unter „Jagdkultur“ sind hier alle mit der Jagd in Zusammenhang stehenden Traditionen und Gebräuche zu verstehen, die mit kulturellen Tätigkeiten und Ausdrucksformen einhergehen, einschließlich Traditionsveranstaltungen, Musik, Kunst, Literatur, Zunftsprache, etc.

